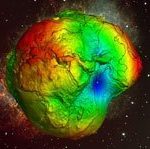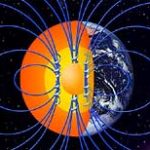In Deutschland könnten nach Schätzungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe immerhin 23 bis 43 Milliarden Tonnen CO2 in solchen salzigen Grundwasserleitern verschwinden – genug, um darin 100 Jahre lang die Emissionen sämtlicher deutscher Kohlenkraftwerke unterzubringen. Ob sie für eine Speicherung des CO2 tauglich und sicher genug sind, versucht beispielsweise das Projekt „CO2SINK“ seit dem 1. April 2004 an einem konkreten Beispiel herauszufinden.
Vorzeigeprojekt mit Modellcharakter

Projekt CO2SINK © GFZ Potsdam / CO2SINK
Ketzin, 30 Kilometer westlich von Berlin. In diesem Städtchen mit rund 4.000 Einwohnern vor den Toren der Metropole arbeitet ein internationales Konsortium aus acht Ländern unter Beteiligung des Deutschen GeoForschungsZentrums Potsdam (GFZ) an einem EU-Vorhaben, bei dem schon bald große Mengen an reinem Kohlendioxid – geplant sind zunächst bis zu 60.000 Tonnen in zwei Jahren – in salzhaltige Grundwasserleiter injiziert werden sollen.
Doch warum gerade Ketzin? Und welche Ziele verfolgen die Wissenschaftler mit CO2SINK? Nun, das geologische Profil der anvisierten Speicherstätte in 600 bis 700 Meter Tiefe ist den Geowissenschaftlern nicht nur gut bekannt, sondern auch repräsentativ für große Teile Europas. Dies ermöglicht eine Übertragung der Forschungsergebnisse auf andere Regionen.
Außerdem ist in Ketzin das nötige technische Equipment und die Erfahrung für eine Gaseinlagerung im Untergrund bereits vorhanden. Rund vierzig Jahre lang wurde hier eine Sandsteinschicht als Zwischenlager für Erdgas aus Sibirien genutzt.
Die Lage in unmittelbarer Nähe zur deutschen Hauptstadt bietet jedoch auch noch einen anderen Vorteil: Hier, mitten im Blickfeld der Öffentlichkeit, könnte bei günstigem Verlauf ein europäisches Vorzeigeprojekt entstehen, dass national und international große Beachtung findet.
Ziele von CO2SINK
Bevor es jedoch mit der eigentlichen Injektion des CO2 losgehen kann, ist eine ganze Reihe von Voruntersuchungen nötig. Gesteinsproben, vielfältige Messungen in Bohrlöchern oder theoretische Vorhersagemodelle liefern den Forschern die gewünschten Daten, um beurteilen zu können, ob der vorgesehene Gasspeicher dicht und sicher genug ist.

Bohrstelle in Knoblauch © GFZ Potsdam / CO2SINK
Erst wenn diese geologischen und umwelttechnischen Überprüfungen bestanden sind, geben die Wissenschaftler und Techniker grünes Licht für den Beginn der CO2-Einlagerung die unter hohem Druck über eine spezielle Injektionsbohrung erfolgt. Strömt das CO2, das anfangs vor allem aus der Wasserstoffproduktion der chemischen Industrie stammen soll, erstmal in die Tiefe, wird es für die Wissenschaftler, die das Projekt begleiten und überwachen spannend: Welche Probleme treten beim Injektionsprozess auf? Wie verteilt sich das CO2 im Untergrund und wie und wohin verdrängt es das salzhaltige Wasser aus den Poren der Sandsteinschicht? Wie viel CO2 löst sich in der Sole?
Mithilfe von mehreren Überwachungsbohrungen und anderen zum Teil neu zu entwickelnden Methoden müssen sie aber auch kontrollieren, welche Auswirkungen die die CO2-Injektion für die Umwelt hat und ob der Speicher tatsächlich so dicht ist wie angenommen.
Warten auf den Durchbruch
Für die Wissenschaftler in Ketzin gibt es in den nächsten Jahren noch viel zu tun und eine ganze Menge Fragen zu beantworten. Daher wird es in jedem Fall noch mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis in Deutschland im großen Maßstab CO2 tief im Boden eingelagert werden kann. Ketzin könnte, so die Hoffnung der GFZ-Forscher, aber viele grundlegende neue Erkenntnisse über die CO2-Speicherung liefern und damit zum Durchbruch für die neue Technologie beitragen.
Stand: 24.02.2006
24. Februar 2006