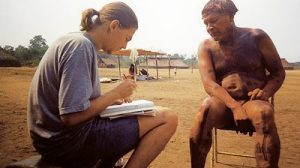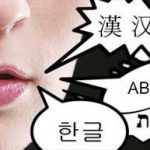Wie der Mensch ursprünglich zur Sprache gekommen ist, bleibt anthropologische Spekulation. Denn heute entstehen einzelne Sprachen immer aus anderen Sprachen und Dialekten, in der Regel durch Sprachwandel.

Wie aus Übergängen Grenzen werden
Wie man sich das im Großen vorstellen könnte, hat 1872 der deutsche Philologe Johannes Schmidt so beschrieben: Man denke sich, auf einer schiefen Ebene angeordnet, eine Reihe untereinander kontinuierlich verständlicher Varietäten A bis X einer Sprache. Wenn nun aber eine davon ein Übergewicht bekommt, durch politische, religiöse, soziale oder sonstige Verhältnisse, dann verdrängt sie ihre Nachbarn. Dies aber führt dazu, dass nun ursprünglich nicht benachbarte Sprachformen aneinandergrenzen. Aus den stetigen Übergänge der schiefen Eben werden so klar abgegrenzte Stufen.
Im Kleinen vollzieht sich dieser Prozess über Lautverschiebungen und Neuerungen in Morphologie, Syntax und Semantik. Sie führen zu unterschiedlichen, zunächst aber noch gegenseitig verständlichen Sprachen. Die Tochtersprachen des Vulgärlateinischen haben sich so aus einem Dialektkontinuum herausgebildet – anfangs, bis ins Mittelalter hinein, noch überdacht vom klassischen Schriftstandard. Italienisch, Französisch, Spanisch und andere mehr wurden aber bald als regelrechte Sprachen empfunden und nicht mehr als neulateinische Dialekte.
Anders ist dies beim Aramäischen, dessen moderne Varianten heute von christlichen und jüdischen Minderheiten im Nahen und Mittleren Osten und der Türkei gesprochen werden. Bei ihnen spricht man bis heute von den „neuaramäischen Dialekten“, obwohl sie sich voneinander viel stärker unterscheiden als die romanischen Sprachen. Die Veränderungen im Laufe der Zeit haben heute die die Verständigung zwischen den Aramäern im Osten und Westen unmöglich gemacht.