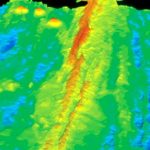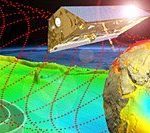Gewaltige Explosionen entstehen in der Eifel und anderswo vor allem dann, wenn es im Untergrund zum Kontakt zwischen Magma und Grundwasser kommt. Das Wasser verdampft in Bruchteilen von Sekunden und es entsteht ein gewaltiger Druck, der alles darüber liegende Gestein wegsprengt. Vulkanologen sprechen in so einem Fall von einer phreatomagmatischen Eruption.
Übrig bleibt dann am Ende oft nur ein Maar, ein Explosionskrater umgeben von einem mehr oder minder großen Trümmerwall. Zahlreiche der heute oft mit Wasser gefüllten „Augen der Eifel“ sind bis vor 11.000 Jahren auf diese Weise entstanden.
Kilometer hohe Eruptionssäulen
Ist das Magma eines Vulkans dagegen so zähflüssig, dass es beim Aufstieg im Schlot nicht ohne weiteres die Erdoberfläche erreicht, kommt es zu gewaltigen Gasblasen im Untergrund, die mit steigendem Druck schließlich die Gesteinsdecke sprengen und plötzliche Ausbrüchen auslösen. Dabei entsteht kaum Wasserdampf, dafür aber werden große Mengen an vulkanischem Lockermaterial wie Bimsstein, Asche und Lavafetzen teilweise Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert, die mit der Zeit wieder auf die Erde fallen. Dort lagern sie sich in bis zu Meter dicken Schichten auf den Vulkanhängen und in der Umgebung ab. Auf dieses Prinzip gehen viele der zahlreichen Schlackenkegel in der Eifelregion zurück.
Es gibt aber auch Mischformen, bei denen es etwa zu einer phreatomagmatischen Initialzündung und anschließend dann zu „trockenen“, so genannten pyroklastischen Eruptionen kommt – oder umgekehrt.