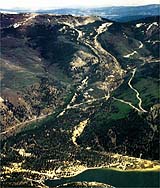Von Alaska bis Feuerland, von Madrid bis Wladiwostok, vom Atlas bis zum Kap der Guten Hoffnung, nirgendwo ist man vor Ihnen sicher: Erdrutsche zählen zu den am weitesten verbreiteten geologischen Gefahren auf der Welt. Schon aus der Zeit um 1770 vor Christus stammen deshalb erste schriftliche Belege über die Folgen solcher Extremereignisse. Diese damals von Erdbeben ausgelösten Erdrutsche sperrten in China die Flüsse Yi und Lo und führten zu großen Überschwemmungen.
Auch die Einwohner Perus sind seit Jahrtausenden gut vertraut mit solchen Katastrophen. Sie haben sogar unterschiedliche Worte dafür erfunden, um die verschiedenen Formen zu beschreiben. Als „Huaico“ bezeichnet man in Peru eine Lawine mit größeren oder kleinen Gesteinsbrocken, „Ilapana“ dagegen beschreibt einen gemächlichen, ruhigen Schlammstrom.
Obwohl das Wissen darüber wann und wo Erdrutsche auftreten in letzter Zeit erheblich gewachsen ist, scheinen die Auswirkungen, den solche Extremereignisse verursachen, doch immer größer zu werden. 1970 starben in Südamerika 18.000 Menschen bei einer einzigen Schlamm- und Gerölllawine, 1985 waren es bei einer ganzen Serie solcher Erdrutsche in Kolumbien sogar fast 25.000. Die finanziellen Schäden aus diesen Katastrophen überschreiten in Ländern wie den USA, Italien, Japan, Indonesien oder Indien jedes Jahr regelmäßig die Milliardengrenze.
In der Öffentlichkeit aber werden die Folgen von Erdrutschen trotzdem noch immer unterschätzt und als Launen der Natur betrachtet. Die Auswirkungen von Erdrutschen tauchen in Berichten und Veröffentlichungen meist nicht detailliert auf. Meist fließen sie der Einfachheit halber in die Zahlen der spektakulären Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche ein.