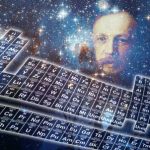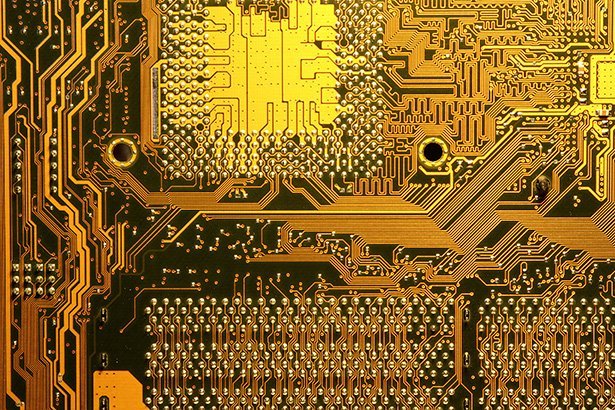Seltsamerweise scheint dies aber beim Gold nicht der Fall zu sein – aber warum? Die Reaktionsträgheit des Goldes hat die gleiche Ursache wie sein Glanz. Die relativistischen Effekte des schweren Kerns lassen die Elektronen besonders schnell um den Kern rasen, gleichzeitig rückt das äußere Orbital näher an den Kern. Als Folge ist das Außenelektron besonders fest an den Kern gebunden. Um es aus der Atomhülle zu reißen, sind Energien nötig, die nur sehr Bindungspartner aufbringen können – dazu gehören Fluor, Chlor und andere hochreaktive Halogene.
Das Rätsel der Aurophilie
Und noch etwas kommt hinzu: In metallischem Gold, aber auch in Goldkomplexen sind die einzelnen Atome besonders eng miteinander verbunden. Ihr Abstand ist deutlich geringer als er eigentlich sein dürfte und in manchen Fällen kann die Bindungsenergie zwischen zwei Goldatomen sogar höher liegen als bei einer Wasserstoffbrückenbindung. Diese sogenannte Aurophilie gab Forschern lange Rätsel auf. Denn wenn die Außenelektronen der Goldatome wie bei Metallen typisch einen „See“ aus delokalisierten Elektronen bilden, bekommen die Atomrümpfe dadurch eine positive Ladung – sie müssten sich eher abstoßen. Stattdessen aber scheinen sie sich beim Gold anzuziehen.
Die Erklärung dafür liefern ebenfalls die relativistischen Effekte im Goldatom. Die Kontraktion der äußeren Orbitale und die hohe Geschwindigkeit der Elektronen führen dazu, dass die äußerste volle Elektronenschale, das 5d-Orbital quasi „aufgebrochen“ wird. Gleichzeitig schirmen die kontrahierten inneren Elektronenorbitale die Kernladung besser ab. Das erleichtert es den Goldatomen, sich untereinander und mit anderen Metallen zu verbinden. Auch die gute Legierbarkeit von Gold lässt sich damit erklären.
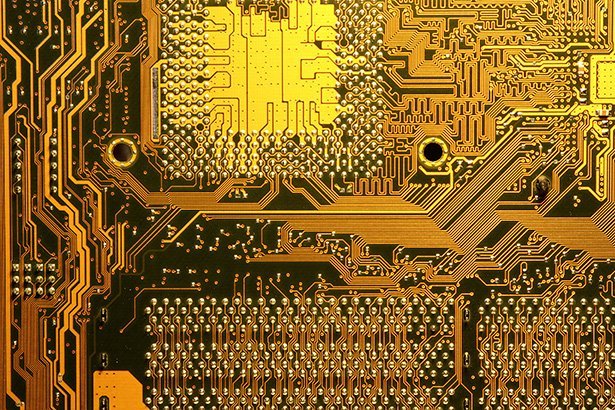
Wegen seiner guten Leitfähigkeit, der Biegsamkeit und der Beständigkeit gegenüber Korrosion wird © Maxiphoto/ iStock.com
Blattgold und Leiterbahnen
Diese Aurophilie erklärt eine weitere ungewöhnliche Eigenschaft des Goldes: Das Edelmetall besitzt von allen Elementen die beste Formbarkeit. Es ist weich, biegsam und gleichzeitig doch so stabil, dass es selbst in dünnsten Schichten nicht reißt. Eine Feinunze Gold – das entspricht rund 31,1 Gramm – kann zu einer Goldfolie von knapp 28 Quadratmetern ausgeschlagen werden. Im alten Japan nutzten Künstler Blattgold von nur 100 Nanometern Dicke, um ihre Gemälde zu verzieren – das dünnste Blattgold der Welt.
In der Nanotechnologie lassen sich inzwischen sogar Golddrähte herstellen, die nur ein Atom dick sind. Nicht ganz so dünne Golddrähte kommen heute als Leiterbahnen in vielen elektronischen Bauteilen vor. Weil das Gold nicht korrodiert, Elektronen gut leitet und weniger spröde ist als alle anderen Metalle, sind diese Leiterbahnen besonders beständig, haltbar und effektiv.
Auch in der Raumfahrt macht man sich diese Eigenschaften zunutze: Viele Satelliten und Raumsonden sind mit hauchdünner Goldfolie überzogen, weil diese die Wärmestrahlung der Sonne gut reflektiert und so die Elektronik vor der Überhitzung schützt.
Nadja Podbregar
Stand: 27.04.2018
27. April 2018