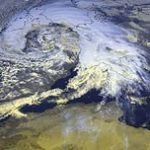In den Wolken spielen sich kompliziertere Prozesse ab, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Dabei ist das faszinierendste wohl das Phänomen des „unterkühlten“ Wassers: Denn noch bei Temperaturen von unter –40° Celsius können Regentropfen in den Wolken flüssig bleiben. Doch warum gefriert das Wasser nicht schon wie am Erdboden bei 0° Celsius und wieso ist das für die Niederschlagsbildung relevant?
Ohne Eis kein Regen
Wasser braucht zum Gefrieren eine Art „Geburtshelfer“, die so genannten Gefrierkerne. Diese sind ähnlich wie die Kondensationskerne winzige Partikel aus Staub, Salzkristallen oder sonstigen Verunreinigungen. An der Erdoberfläche wimmelt es nur so von diesen mikroskopisch kleinen Partikeln, in der Luft sind sie allerdings rar gesät. Daher ist es völlig normal, dass in einer Wolke mit lauter „gefrierwilligen“ Wassertröpfen nicht genug Kristallisationskerne vorhanden sind. Das Wasser wird gezwungen, flüssig zu bleiben. Doch diese kleinen Wolkentröpfen sind zu klein und leicht, um direkt als Niederschlag zur Erde zu fallen. Sie müssen zunächst gefrieren und anwachsen, um schwer genug zum „Herunterfallen“ zu werden.
Je tiefer die Temperatur, also je höher die Luftmassen steigen, desto einfacher wird es für die H2O-Moleküle, sich an die Gefrierkerne anzulagern. Sobald sich also in der Höhe die ersten Eiskristalle bilden konnten, wachsen diese rasend schnell an. Von nun an „saugt“ das Eis die Feuchtigkeit geradezu aus der Luft auf und lässt gleichzeitig weitere Wolkentröpfchen verdunsten. Durch diesen Prozess müsste die Wasserdampfsättigung der Luft eigentlich unter 100 Prozent sinken. Doch da H2O prinzipiell die vollständige Sättigung der Luft anstrebt, werden die unterkühlten Wolkentröpfchen zur weiteren Verdunstung gezwungen. Die dabei freigewordenen Moleküle lagern sich umgehend an den Eiskristallen an und der Prozess beginnt von Neuem. Eine Eiswolke entsteht.
Die Wolke im Kühlschrank
Einen vergleichbaren Prozess hat jeder vielleicht schon einmal im heimischen Kühlschrank beobachtet. Legt man ein frisches Stück Brot hinein, so ist es spätestens am nächsten Tag knochentrocken. Was ist passiert? Das im Brot enthaltene Wasser verdunstet, bis die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank 100 Prozent erreicht hat. Dieser Wasserdampf fühlt sich nun zum Eisfach hingezogen und lagert sich dort ab – die Eiskristalle wachsen und das Brot muss immer mehr Feuchtigkeit abgeben. Dies führt zu den bekannten Folgen, dass einerseits das Brot langsam austrocknet und andererseits das Eisfach immer mal wieder abgetaut werden muss. Im Vergleich mit der Niederschlagsentstehung übernimmt das Wasser im Brot die Rolle der Wolkentröpfchen und das Gefrierfach die der Eiskristalle.