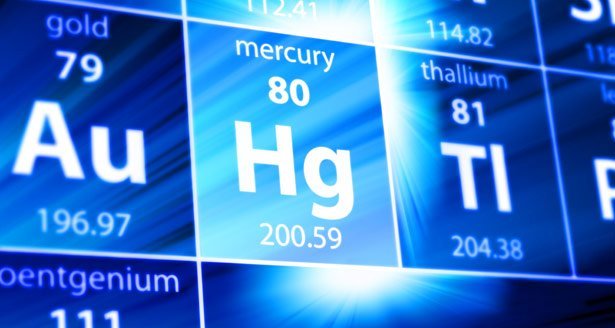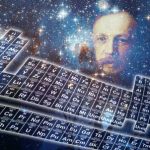Wegen seiner Giftigkeit spielt Quecksilber heute längst keine so große Rolle in der Medizin mehr wie in Antike und Mittelalter. Ganz aus der Heilkunst verschwunden ist das Metall aber nicht: Noch immer stecken beispielsweise 1.300 bis 2.200 Tonnen davon in den Mündern von EU-Bürgern – in Form von Zahnfüllungen.
Weil Quecksilber mit vielen Metallen spontan Legierungen bildet, eignet es sich hervorragend, um Zahnlöcher zu stopfen. Vermischt man es mit Stoffen wie Silber und Zinn, entsteht zunächst eine flexibel formbare Masse. In den Zahn gedrückt, härtet diese jedoch bald aus: ein sogenanntes Amalgam entsteht. Es ist als Plombe besonders haltbar und kann zudem das Bakterienwachstum hemmen.
Amalgam im Zahn
Das bisschen Quecksilber, das sich beim Kauen abschaben könnte, schadet den Patienten der gängigen Annahme nach nicht. Trotzdem gibt es immer wieder Bedenken, dass auch die geringe Belastung auf Dauer womöglich ein Risiko darstellt. Aus diesem Grund kommen inzwischen zunehmend Alternativen zum Einsatz. Schwangere und stillende Frauen sowie Jugendliche unter 15 Jahren dürfen laut einer EU-Verordnung seit Juli 2018 sogar gar keine Amalgamfüllungen mehr erhalten.
Neben Zahnfüllungen findet sich Quecksilber bis heute in vielen Impfstoffen: als Konservierungsmittel oder Adjuvans. Das Metall ist dort lediglich in homöopathischen Dosen enthalten, die Studien zufolge völlig unbedenklich sind. Trotzdem gibt es für die meisten generell empfohlenen Schutzimpfungen mittlerweile quecksilberfreie Alternativen.