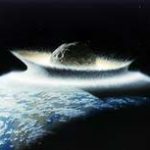Früher war alles besser: Diese Weisheit ist zwar umstritten, auf den Ngorongoro-Krater jedoch scheint sie zuzutreffen. Denn Nashörner sind längst nicht die einzigen Tiere, die mittlerweile in der Caldera um ihr Überleben fürchten.
Wie Victor Runyoro von der Ngorongoro Conservation Area Authority, der Schutzgebietsverwaltung, auf einem Nashorn-Workshop in der NCA im Jahr 2003 berichtete, ergeht es beispielsweise der Elenantilope Taurotragus oryx ähnlich. Deren Zahl im Krater ist in den letzten 30 Jahren auf ein Drittel des ehemaligen Bestandes zusammengeschrumpft. Auch Hyänen, Löwen oder Gnus, so Runyoro, sind dort immer seltener zu beobachten.

Die Büffel dagegen gehören laut Runyoro zu den wenigen Gewinnern im „Kampf ums Überleben“. Existierten um 1960 gerade mal ein paar einzelne Exemplare im Krater gibt es dort inzwischen mehrere tausend Stück von ihnen. Sie profitierten davon, dass Mitte der 1970er Jahre die Massai sich nicht mehr dauerhaft im Krater aufhalten durften und damit die Konkurrenz um das Weidegras geringer wurde.
Doch da, wo Büffel leben, sind auch Zecken. Diese aber können gefährliche Erreger übertragen und haben deshalb schön öfter zu Seuchen unter den Wildtieren im Krater geführt. So geschehen im Jahr 2000, als 1.000 Büffel, 250 Gnus, 100 Zebras, und fünf Rhinozerosse während einer verheerenden Dürre im Krater starben. Schuld waren aber nicht nur Wassermangel und fehlende Nahrung, so Winston und Lynne Trollope von der Fort Hare Universität in Südafrika, sondern auch die sich daraus ergebende erhöhte Anfälligkeit für Parasiten und andere Krankheitserreger. Überträger: vermutlich Zecken.
Gefährliche Inzucht
Zu den bedrohten Tierarten im Krater gehören erstaunlicherweise auch die Löwen. Dabei haben sie es eigentlich gut. Gnus, Gazellen, Antilopen und Büffel gibt es hier im Überfluss. Sie sorgen für ein „Tischlein-Deck-Dich“ der Natur, bei dem die Könige der Tiere nur noch zugreifen müssen. Und auch vom Menschen haben die Raubkatzen nichts zu befürchten. Wilderer werden effektiv aus dem Kratergebiet ferngehalten und die zahlreichen Touristen können für die Rudel zwar nervig sein, wenn sie die Tiere bei der Siesta stören, eine reale Gefahr geht von ihnen aber nicht aus.

Dennoch fürchten Wissenschaftler wie Professor Craig Packer aus der Abteilung für Ökologie, Evolution und Verhalten der Universität von Minnesota um den Bestand im Ngorongoro-Gebiet. Dies liegt vor allem daran, dass der Löwenbestand im Krater fast vollständig von der Außenwelt isoliert ist. Wanderungsbewegungen wie früher, als immer wieder Tiere den Krater verließen und neue aus den umliegenden Gebieten der NCA einwanderten, gibt es kaum noch. Dafür sorgen schon die im Schutzgebiet wohnenden Massai, die gnadenlos Jagd machen auf den König der Tiere, sobald er in der Nähe ihrer Viehherden auftaucht.
Rund 50 Löwen gibt es im Ngorongoro-Krater heute. Die Tiere können sich aber nur untereinander fortpflanzen und fast alle stammen von wenigen Männchen ab. Diese Inzucht und die damit verbundene genetische Armut sorgen jedoch für massive Probleme. Wissenschaftler haben festgestellt, dass bei den meisten Männchen die Spermien missgebildet sind und es dadurch Schwierigkeiten bei der Fortpflanzung gibt.
Aber auch das Immunsystem vieler Löwen im Ngorongoro-Krater ist durch die Inzucht geschwächt und die Tiere werden anfällig für Infektionskrankheiten wie Staupe. Besonders schlimm war die Situation im Jahr 2000 als der Löwenbestand innerhalb weniger Monate von 67 Tieren auf 41 zurückging. Ursache: eine unnatürliche Häufung von Krankheiten.
Blutauffrischung nötig
Zwar hat sich die Situation mittlerweile ein bisschen entspannt, aber Wissenschaftler wie Packer halten trotzdem – ähnlich wie bei den Nashörnern – eine Blutauffrischung im Reservat für dringend notwendig. Packer plant deshalb zusammen mit der Nationalparkverwaltung von Tansania, zunächst einmal einige Löwenweibchen in den Krater zu „importieren“. Funktioniert das Experiment, könnten in Zukunft auch ein oder mehrere Männchen ins Exil geschickt werden und durch neue aus dem Umland des Kraters oder anderen Teilen Afrikas ersetzt werden.
Stand: 18.11.2005