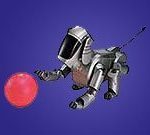Der Schritt vom Zuhören zum Dialog, also die Signalübertragung in umgekehrter Richtung vom Chip zum Neuron, gelang erstmals 1995 und rückte den eher zurückhaltenden Max-Planck-Forscher ins Rampenlicht der internationalen Presse: „Neuron talks to chip, and chip to nerve cell“, titelte zum Beispiel die NEW YORK TIMES. Von da an konnte sich Fromherz über mangelnde Aufmerksamkeit der Medien nicht mehr beklagen.
Allerdings ist vieles, was über ihn geschrieben wird, mehr „Fiction“ als „Science“ und hat mit seinem Forschungsalltag wenig gemein. Die Vision eines im Gehirn implantierten Chips, der Wahrnehmung und Bewusstsein willkürlich steuert, mag ein phantastischer Stoff für Kinofilme wie „Matrix“ sein – doch die Wissenschaft ist weit davon entfernt.
Netze als Ziel
Was also ist das Ziel? „Wir wollen die Dynamik der Gedächtnisbildung von neuronalen Netzwerken studieren. Man weiß sehr viel darüber, wie einzelne Neuronen und Synapsen arbeiten, dagegen gibt es zur Frage, wie die dadurch bestimmte Dynamik eines neuronalen Netzes funktioniert, zwar viele Theorien, aber kaum Experimente. Wir versuchen gegenwärtig in einem nächsten Schritt, auf geeignet konstruierten Halbleiterchips kultivierte neuronale Netze zu erzeugen“, sagt Fromherz.
Weil die bereits etablierten Blutegel- Neurone in Kultur untereinander keine synaptischen Kontakte knüpfen, mussten sie den Nervenzellen der Schlammschnecke Lymnaea stagnalis weichen. Die Schnecken- Neurone sind ebenfalls ausreichend groß, um sie einzeln auf einem Chip zu platzieren und – da sie in Kultur effiziente elektrische Synapsen ausbilden – kleine Netzwerke zu bauen. Nicht ganz unwesentlich: Solche kleinen Netze haben bei wirbellosen Tieren bereits eine biologische Funktion.