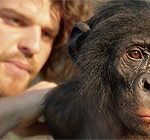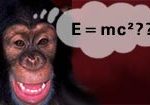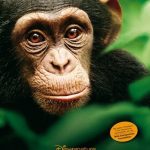Als Jane Goodall mit ihrer Schimpansen-Forschung begann, galten Tiere als von Natur aus friedlich. Der vorherrschenden Lehrmeinung nach töteten sie zwar ihre Beute, Kämpfe unter Artgenossen jedoch waren so ritualisiert und durch instinktive Verhaltensweisen kontrolliert, dass Todesfälle dabei eher Unfälle als Absicht waren. Aggression, Angriffe und Kriege waren dieser Sichtweise nach ein erst vom Menschen entwickeltes „unnatürliches“ Verhalten.
Erstmals tierische Kriege beobachtet
Doch Goodall machte bei ihren Schimpansen in Gombe völlig andere Erfahrungen. So beschrieb die Affenforscherin, dass es auch innerhalb einer Schimpansengruppe zu Gewalt kam: Die Männchen kämpften darum, die Führungsposition ihrer Gruppe einzunehmen und taten dies auch mit körperlicher Gewalt. Wechselte das Alpha-Männchen, konnte die Forscherin beobachten, dass es nicht davor zurückschreckte, den Nachwuchs andere Männchen der eigenen Gruppe zu töten. Dadurch verschaffte sich der neue „Chef“ der Schimpansengruppe schneller die Möglichkeit, sich mit den Weibchen zu paaren. .
Und nicht nur um die Rangordnung innerhalb der eigenen Gruppe kämpfen Schimpansen: Goodall entdeckte, dass es auch Kämpfe zwischen Schimpansengruppen gab, die bis zum gewaltsamen Tod einzelner Individuen gingen. Solche koordinierten und manchmal tödlich endenden Angriffe gegen andere Gruppen ihrer eigenen Art bezeichnete Goodall als regelrechte Kriege.
Von Natur aus gewalttätig
Warum es zwischen Artgenossen aus verschiedenen Schimpansengruppen zu solchen gewalttätigen Auseinandersetzungen kam, konnte Goodall zunächst nur vermuten. Sie ging davon aus, dass die Kämpfe insbesondere dann ausbrachen, wenn die Menschenaffen ihr Territorium in Gefahr sahen oder neue Nahrungsquellen erobern wollten. Andere Wissenschaftler widersprachen dem und stuften diese Gewaltausbrüche unter den Schimpansen als „nicht natürlich“ ein. Stattdessen sollte die Nähe zum Menschen und sein Eingriff in die Lebensräume die Ursache der Gewalttätigkeit sein, so ihre Hypothese.