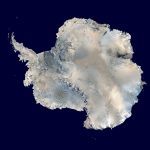Auch ein Held braucht Hilfe. Doch das fällt meistens erst dann auf, wenn diese Hilfe ausnahmsweise mal nicht zur Stelle ist. So einst geschehen in den Wassern des antarktischen Südpolarmeeres. Als die Walfänger dort im 20. Jahrhundert besonders verheerend wüteten, trieben sie nicht nur die Wale an den Rand des Aussterbens, sondern gefährdeten auch das gesamte Ökosystem – allerdings nicht so wie erwartet.

Das Krill-Paradox
Logisch gedacht: Wenn es weniger Wale gibt, die Krill fressen, müsste das eigentlich dazu führen, dass die Population dieser kleinen Plankton-Krebschen explodiert. Doch das tat sie nicht. Im Gegenteil: Sie brach drastisch ein, um über 80 Prozent. Was war passiert? Lange rätselten Wissenschaftler über dieses sogenannte Krill-Paradox.
Heute weiß man, dass die Nahrungsketten in den Meeren der Antarktis keineswegs nur linear á la „Wal frisst Krill und Krill frisst Kieselalge“ aufgebaut waren. Vielmehr lassen sie sich als Kreislauf beschreiben, bei dem Wale einen direkten Einfluss auch auf das unterste Mitglied der Nahrungskette, das Phytoplankton, haben.
Die im Südpolarmeer einst reichlich vorhandenen Meeressäuger düngten das pflanzliche Plankton mit ihrem eisenreichen Kot, der entscheidend für das Wachstum von Kieselalge und Co ist. „Ein Viertel des von den Walen freigesetzten Eisens könnte vom Phytoplankton aufgenommen worden sein“, schätzen Forschende um Matthew Savoca von der Stanford University. Die Kieselalgen konnten dank dem düngenden Wal gedeihen und vom Krill abgeweidet werden, der wiederum im Magen der Wale landete und dort wieder zu eisenreichem Kot recycelt wurde.