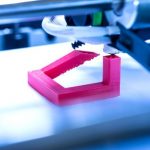Schnecken produzieren es, einige Krebse nutzen es und Quallen bestehen sogar fast vollständig daraus: Hydrogel. Diese in nasser Umgebung glibbrige Masse besteht zu mehr als 90 Prozent aus Wasser, verliert aber dennoch selbst eingetaucht nicht seine Struktur. Gleichzeitig kann ein Hydrogel erstaunlich fest werden, enormen Kräften standhalten oder auf nahezu allen Oberflächen kleben.

Pulver, Gel oder Feststoff
Diese vielseitigen Fähigkeiten verdanken die Hydrogele ihrer besonderen Zusammensetzung: Ihr Gerüst aus vernetzten Polymeren ist nicht wasserlöslich, trotzdem kann es große Mengen an Wasser an sich binden. Das dreidimensionale Netzwerk aus physikalisch oder chemisch miteinander verknüpften Polymerketten quillt in feuchter Umgebung auf und wird weich und gelartig. Diese Eigenschaft nutzt man beispielsweise bei Superabsorbern aus: Diese Hydrogele sind in trockener, kompakter Form in Babywindeln oder Damenbinden integriert. Kommen sie mit Flüssigkeit in Kontakt, quillt das kompakte Material zum Gel auf und schließt so die Flüssigkeit sicher ein.
Umgekehrt kann ein Hydrogel aber durch äußere Einflüsse wie Wärme, elektrische Felder, UV-Licht oder Veränderungen des pH-Werts auch Wasser abgeben und dann seine Eigenschaften komplett verändern: Es wird zum trockenen Pulver, zum stark haftenden Kleber oder einem festen Gerüst. Dabei bilden sich teilweise zusätzliche Verstrebungen im Polymernetz, die dann zur Haftkraft oder Stabilität des Hydrogels beitragen.
Der Vorteil dabei: Bei vielen Hydrogelen sind diese Wechsel vollständig reversibel – sie können je nach Umweltbedingung fast beliebig oft zwischen dem gelartigen und dem festen Zustand wechseln. „Der Zyklus von Binden, Trennen und wieder Binden kann mehrfach wiederholt werden, ohne dass das Material seine Fähigkeit zur Selbstheilung verliert“, erklärt Ameya Phadke von der University of California in San Diego.