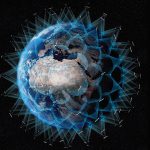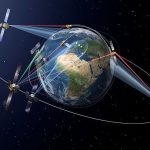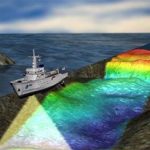Welche Auswirkungen hätte es, wenn jemand eine oder mehrere Interkontinental-Verbindungen Europas zerstören würde? Und wer sind die möglichen Täter für solche Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur? Schneiden sie sich nicht automatisch auch ins eigene Fleisch?

Kabelkappung mit nur begrenzten Auswirkungen
Anders als viele andere Regionen hätte der Ausfall nur eines Unterseekabels für Europa kaum Folgen: „Angesichts der hohen Zahl an Kabeln und der großen Redundanz wäre ein EU-weiter Internet-Blackout höchst unwahrscheinlich“, erklären Jonas Franken von der TU Darmstadt und seine Kollegen. Solange es für die Daten noch ausreichend schnelle alternative Routen gibt, wäre dies vermutlich für Nutzer kaum zu bemerken.
„Allerdings könnte ein koordinierter Angriff auf mehrere Kabel signifikante Störungen verursachen“, so Franken weiter. Denn dann werden die Ausweichrouten knapp und die verfügbare Bandbreite für die interkontinentalen Datenübertragungen sinkt. Denkbar wäre ein solches Szenario beispielsweise, wenn eine Landestation zerstört wird, an der gleich mehrere Unterseekabel enden. Dies ist vor allem bei den Stationen in Großbritannien der Fall, an denen gleich mehrere Transatlantikkabel einlaufen. Aber auch ein Angriff auf die Flaschenhälse im Roten Meer oder in der Straße von Gibraltar haben das Potenzial, gleich mehrere Kabelverbindungen zu kappen.
Ohne die Transatlantikkabel läuft bei uns nichts
Besonders schwerwiegende Auswirkungen hätte es für Europa, wenn die Transatlantikverbindungen unterbrochen werden würden. Das ist zwar aufgrund der großen Zahl der Unterseekabel ein fast unmögliches Szenario, wäre aber verheerend: „Wenn wir in Europa morgen unsere Kabelleitungen in die USA verlieren, dann würde hier das Internet ganz einfach zusammenbrechen“, beschrieb Jean-Luc Vuilemin vom französischen Telekommunikationsunternehmen Orange die Folgen jüngst im SWR. „Ungefähr 80 Prozent des Inhalts, den unsere Nutzer konsumieren, kommen aus den USA.“ Fast alle Programme, Plattformen und Websites der großen US-Tech-Konzerne benötigen trotz regionaler Rechenzentren in Europa auch die Verbindung in die USA.