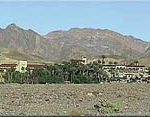„The next war in the Middle East will be fought over water, not politics“ – das prophezeite Boutros Ghali im Jahr 1985. Mit seiner Prognose lag der spätere Generalsekretär der Vereinten Nationen – soweit es sich derzeit absehen lässt – falsch. Aktuelle Konflikte im Vorderen Orient werden sehr wohl um „politics“ ausgefochten. Um Wasser geht es dabei kaum. Im Kern allerdings hatte Boutros Ghali recht: Wasser ist ein zentrales Politikum, nicht nur im Vorderen Orient, sondern auch in Süd- und Zentralasien.

Flüsse kennen keine Grenzen
Hinter vielen vermeintlich politischen und religiösen Konflikten steckt das Wasser – sei es physischer Wassermangel, auch aufgrund des globalen Klimawandels, oder struktureller Wassermangel wegen der asymmetrischen Machtbeziehungen der involvierten Akteure. Knappe Wasserressourcen können vor allem dann zum Konflikt führen, wenn große Ströme oder wichtige Grundwasserleiter Grenzen überschreiten.
Solche „transboundary waters“ sind ein weltweit verbreitetes Phänomen: Nicht weniger als 263 Seen und Flüsse sind grenzüberschreitend, 145 Nationen haben gemeinsam Anteil an Wasserflächen, 13 internationale Wasserressourcen werden von mehr als zwei Nationen genutzt. Bei transnationalen Strömen sind zumeist die „Oberlieger“– diejenigen die weiter flussaufwärts liegen – im Vorteil, weil sie die Abflüsse kontrollieren können.
Streit am Euphrat und am Mekong
Ein Beispiel ist der Euphrat, dessen Wasser in zunehmendem Maße vom Südostanatolien-Projekt (GAP) in der Osttürkei genutzt wird – zum Schaden der Unterlieger Syrien und Irak. Dieses umfasst 22 Staudämme und 19 Wasserkraftwerke entlang der Flüsse Euphrat und Tigris. Diese reichen bis an die Grenzen von Syrien und dem Irak heran und durch ihre Lage flussaufwärts wäre die Türkei im Prinzip in der Lage, beiden das „Wasser abzudrehen“. In bilateralen Verhandlungen hat die Türkei Syrien und Irak jedoch eine Wassermenge von 500 Kubikmeter pro Sekunde zugesichert.