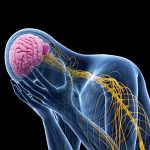Seine Hunde-Experimente machten den russischen Mediziner Ivan Pawlow weltberühmt, denn mit ihnen bewies er das Lernen durch klassische Konditionierung. Dafür kombinierte Pawlow einen eigentlich neutralen Reiz, ein Glockenläuten, immer wieder mit einem zweiten Reiz: der Gabe von Futter. Im Lauf der Zeit lernten seine Hunde, dass die Glocke das Futter ankündigte, und reagierten allein auf das Läuten mit Speichelfluss.

Doch diese Konditionierung hält normalerweise nicht ewig an – sie kann auch ausgelöscht werden. Das passiert beispielsweise, wenn die Glocke zwar immer wieder läutet, aber darauf keine Futtergabe mehr erfolgt. Diese Erfahrungen „überschreiben“ dann gewissermaßen den zuvor gelernten Zusammenhang. Verhaltensbiologen bezeichnen diesen Prozess des Umlernens als Extinktionslernen.
Umlernen bei „schmerzenden“ Dreiecken
Harald Englers Team verfolgt die Hypothese, dass manche Krankheitsbilder mit einem veränderten Extinktionslernen zusammenhängen und dass Entzündungsprozesse das erfolgreiche Umlernen stören können. Gemeinsam mit dem Team der Bochumer Forscherin Sigrid Elsenbruch zeigte seine Gruppe kürzlich einen solchen Effekt bei gesunden Menschen. Diese lernten zunächst, geometrische Formen mit einem Schmerz zu assoziieren. Sie sahen immer wieder Bilder von beispielsweise Dreiecken, Kreisen und Vierecken.
Doch manche dieser Formen, zum Beispiel die Dreiecke, waren mit einem kurzen Schmerzreiz gepaart. Nach der Lernphase bewerteten die Testpersonen die Dreiecke daher negativer als die anderen geometrischen Formen. Am Folgetag fand das Extinktionslernen statt: Nun war keine der geometrischen Formen mehr mit Schmerzen verbunden. Nach dieser Umlernphase sollten die Teilnehmenden nun erneut bewerten, wie negativ sie die verschiedenen Formen empfanden. Dabei erfassten die Forschenden ihre Hirnaktivität mit der funktionellen Magnetresonanztomografie.