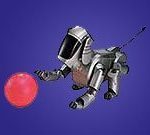Eine der größten Hürden bei der Entwicklung von drahtlosen Sensornetzen – da sind sich die Experten einig – stellt die Energieversorgung der einzelnen Knoten dar. „Prototypisch können wir die Hardware bereits bauen. Allerdings stehen wir noch vor praktischen Schwierigkeiten“, so dazu Kay Römer vom Institut für Pervasive Computing an der ETH Zürich.
Beispiele BTnodes und Specks
Römer und seine Kollegen in Zürich haben in Kooperation mit den Universitäten aus Lancaster und Karlsruhe und Partnern aus Schweden und Finnland „BTnodes“ entwickelt, eine Plattform für Sensornetze, deren Sensorknoten ähnlich wie die Smart Dust Motes aus Berkeley konzipiert sind. Zusammen mit der notwendigen Software werden „BTnodes“ anderen Forschungslaboren zur Verfügung gestellt, die die Motes je nach Eigenbedarf mit bestimmten Sensoren bestücken und konfigurieren können – eine Art Baukasten für Sensornetze.
Auch an der University of Edinburgh arbeitet man an einem eigenen Konzept des intelligenten Staubs. Hier heißen die Sensorknoten „Specks“, bald sollen sie sogar ganze „Specknets“ bilden und das drahtlose „speckled Computing“ ermöglichen. „Jeweils nur einen Kubikmillimeter groß, werden sie im Haushalt, in Supermärkten, in der Kleidung oder im Spielzeug zum Einsatz kommen und nach Gewicht und Farbe – gelb für Temperatur, schwarz für Luftdruck“ – verkauft werden“, so prophezeit es D. K. Arvind, Professor an der School of Informatics in Edinburgh.
Bisher werden sowohl Specks als auch Smart-its durch Batterien mit Strom versorgt – die „Staubkörnchen“ wirken deshalb noch ziemlich klobig. Smart-its sind mehrere Kubikzentimeter groß und werden meist durch Lithium-Batterien oder extern mit Strom versorgt. Die Prototypen der Specks entsprechen der Größe eines 2-Pence-Stücks – oder der einer Knopfzelle, die für Stromzufuhr sorgt.