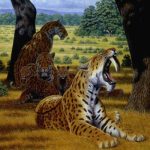Trotz jahrzehntelanger Forschung und Diskussion liegen die Ursachen für die meisten der großen Aussterbephasen heute noch immer im Dunkeln. Inzwischen gibt es zwar fast so viele Hypothesen wie es Wissenschaftler gibt, eindeutige Beweise sind aber noch immer Mangelware. Die liegt nicht zuletzt daran, dass eine ganze Reihe von möglichen Auslösern in Frage kommen.
Die Palette reicht von katastrophalen Vulkanausbrüchen über Meeresspiegelabsenkungen, Eiszeiten und Klimawandel, langanhaltenden Trocken- oder Regenperioden bis hin zu Meteoriteneinschlägen als „Killern aus dem All“. Doch auch jede denkbare Kombination dieser Faktoren ist nicht ausgeschlossen.
Vom Flachmeer zur Wüste?
Lange Zeit galten Klimawandel und Meeresspiegelveränderungen als die unangefochtenen Favoriten unter den Kandidaten. Über lange Perioden der Erdgeschichte hinweg bedeckten weite Flachmeere einen Großteil des heutigen Festlandes. Im Zeitalter des Kambrium vor rund 560 Millionen Jahren lagen beispielsweise mehr als zwei Drittel des nordamerikanischen Kontinents unter zehn bis zwölf Metern Wasser. In diesen warmen lichtreichen Flachmeeren bildete sich eine besonders vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, vergleichbar den heutigen Korallenriffen.
Ausgelöst durch die Wanderung der Kontinente und klimatische Veränderungen, fiel der Meeresspiegel jedoch mehrfach weltweit ab und ließ diese Flachmeere trockenfallen. Der Lebensraum für die zahlreichen Flachwasserbewohner verschwand oder wurde extrem dezimiert. Nach Ansicht vieler Paläontologen löste dieser Rückzug der Meere einige der großen Massenaussterben aus oder spielte zumindestens eine entscheidende Rolle.