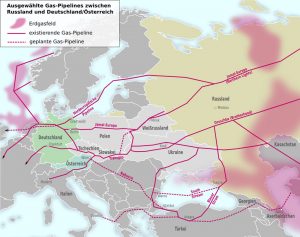Damit das Flüssiggas in Deutschland genutzt werden kann, muss es wieder in den gasförmigen Zustand gebracht und ins deutsche Gasnetz eingespeist werden. Damit dies geschehen kann, sind spezielle LNG-Terminals nötig – von denen Deutschland bisher kein einziges besitzt. Wie könnte Flüssiggas dennoch zu uns gelangen? Und welche Kapazitäten gibt es dafür mit der bestehenden Infrastruktur?

Erster Engpass: die LNG-Tanker
Klar scheint: Russisches Erdgas komplett durch LNG ersetzen zu wollen, wird schwierig. Denn die Transportkapazitäten reichen dafür nicht aus. Der erste Engpass sind die verfügbaren LNG-Tanker. Sie können je nach Bauart zwischen 125.000 und 250.000 Kubikmeter Flüssiggas transportieren. Dieses wird auf den Schiffen in wärmeisolierten Kugeltanks aus Metall oder Membrantanks aus verstärktem Polyurethan gelagert. Eine Flüssiggas-Füllung von 125.000 Kubikmetern entspricht etwa der Erdgasmenge von 75 Millionen Kubikmetern Pipelinegas.
Sollen LNG-Tanker die jährlich rund 160 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas ersetzen, die noch 2020 durch Pipelines nach Europa strömten, müsste die weltweite LNG-Transportkapazität erheblich aufgestockt werden: Nach Angaben des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) in Bremen liegt das Volumen der weltweiten LNG-Tankerflotte bisher bei etwa 103 Millionen Kubikmetern Flüssiggas.
Um das russische Erdgas für ganz Europa durch LNG zu ersetzen, wären nach Schätzungen des ISL zusätzliche Transportkapazitäten für rund 280 Millionen Kubikmeter LNG erforderlich. Das würde bedeuten: Die vorhandenen LNG-Tanker müssen häufiger fahren, ihre Routen aus Asien nach Europa verlagern oder es müssen mehr Tanker her.