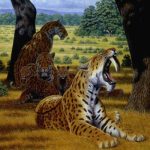Trotz aller methodischen Hürden sind sich die Wissenschaftler heute weitgehend darüber einig, dass es nicht nur der Zufall sein kann, der bei einem Aussterben das Schicksal einer Art entscheidet. Die totale Vernichtung der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit oder das völlige Verschwinden aller Trilobitenarten sind zu ungewöhnlich, um als bloße Laune der Evolution durchzugehen.
Ausgehend von Fossilien und Beobachtungen heutiger ökologischer Gesetzmäßigkeiten lassen sich allerdings einige mögliche Faktoren zusammenstellen, die ein Aussterben einer Art begünstigen. Alle diese Faktoren können, müssen aber nicht, das Aussterben einer Art begünstigen. Welche Faktoren im Einzelfall wann und wie wirken, ist nach wie vor kaum bekannt.
Kleine Populationen
Biologen, die sich mit Populationsdynamik und Artenschutz befassen, haben festgestellt, dass es eine Art untere Grenze der Überlebensfähigkeit von Populationen zu geben scheint. 1967 formulierten Robert MacArthur und E.O.Wilson ihre Theorie der so genannten „minimum viable Population“ (MVP) so: „Populationen über diesem Wert sind praktisch immun gegen das Aussterben, solche unter der Grenze werden wahrscheinlich sehr schnell verschwinden.“ Die Ursachen: Kleine Gruppen sind anfälliger gegenüber äußeren Faktoren: Krankheit, Feuer oder andere lokale Störungen können zum Aussterben einer Art führen, wenn es nur eine kleine Population von ihr gibt. Zudem ist der Genpool einer kleinen Population sehr begrenzt, Veränderungen der Umwelt können daher meist nur schwer abgefangen werden.
Begrenztes Verbreitungsgebiet
Je weiter verbreitet eine Art ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass alle Populationen durch ein einziges Ereignis ausgerottet werden können. Kommt sie dagegen nur in einem eng umgrenzten Gebiet vor, gelten die ähnlichen Risiken, wie bei kleinen Populationen: Eine „Pechsträhne“ mit lokaler Dürre, eine Epidemie oder das plötzliche Auftauchen von übermächtiger Konkurrenz oder Fressfeinden in diesem Lebensraum vernichtet dann nicht nur die lokale Population, sondern damit gleichzeitig auch die letzten ihrer Art. Anfang der 1980er Jahre vernichtete beispielsweise ein Virus 95 Prozent aller Seeigel der Gattung Diadema in der Karibik. Doch da diese Gattung auch anderswo vorkam, konnte sie sich wieder von diesem Schlag erholen.