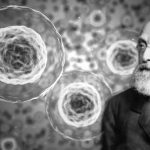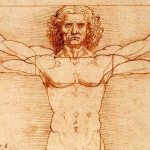Mit den Experimenten zur Elektrizität und dem Phänomen des Blitzes ist Benjamins Franklins Forscherdrang noch lange nicht erschöpft. Er liest, experimentiert und forscht auf so unterschiedlichen Gebieten wie der der Zeitmessung, Meteorologie, der Meereskunde oder der Medizin.

Wolken, Winde und Hagel
Schon vor seinen Versuchen zur Natur der Blitze entdeckt Franklin eine fundamentale Eigenschaft von Wolken und Stürmen: Er ist der erste, der erkennt, dass Wolken auch entgegengesetzt zur am Boden vorherrschenden Windrichtung ziehen können. Den Anstoß dazu gibt ihm ein Himmelsschauspiel: Am 21. Oktober 1743 bereitet sich Franklin darauf vor, eine Mondfinsternis zu beobachten, als heranrasende Sturmwolken ihm die Sicht auf den Erdtrabanten nehmen. Wenige Tage später jedoch liest er, dass die Menschen in Boston die Mondfinsternis sehen konnten – bei ihnen traf der Sturm erst deutlich später ein.
Das Merkwürdige jedoch: Boston liegt gut 100 Kilometer nordöstlich von Philadelphia und zur Zeit der Mondfinsternis herrschte Nordostwind. Dieser hätte die Sturmwolken daher nach Westen treiben müssen. Stattdessen bewegten sich die Wolken gegen den Wind. Der Wind konnte demnach nicht der einzige Einflussfaktor für die Bewegung großräumiger Wetterereignisse sein. Franklin stellt die Vermutung auf, dass der Luftdruck in Form von Hoch- und Tiefdruckgebieten die entscheidende Triebkraft der Sturmwirbel sein muss – eine korrekte Annahme.
Über noch etwas sinniert der Forscher: Warum kann es selbst im Hochsommer hageln? Eigentlich ist es dann ja viel zu warm, um die eisigen Klumpen zu bilden. Franklins Schlussfolgerung: Dort, wo der Hagel seinen Ursprung hat – hoch in der Atmosphäre – muss es deutlich kälter sein als in Bodennähe. Noch in der Wolke muss der Regen dadurch zu Hagel gefrieren. Auch damit liegt Franklin richtig, wie Messungen später beweisen.