Auf der Suche nach haltbaren Archiven erlebt heute eine scheinbar längst veraltete Technologie eine Renaissance: der Mikrofilm. Früher waren diese mittels Fotobelichtung hergestellten, verkleinerten Abbilder von Dokumenten in Bibliotheken und Zeitungsarchiven allgegenwärtig. Doch mit dem Aufkommen von Computern, Scannern und Internet geriet diese analoge Technik ins Hintertreffen: zu umständlich in der Herstellung, zu schwer zu durchsuchen und vor allem nicht online abrufbar. Im digitalen Zeitalter war der Mikrofilm damit eher eine Art Dinosaurier – dachte man jedenfalls.
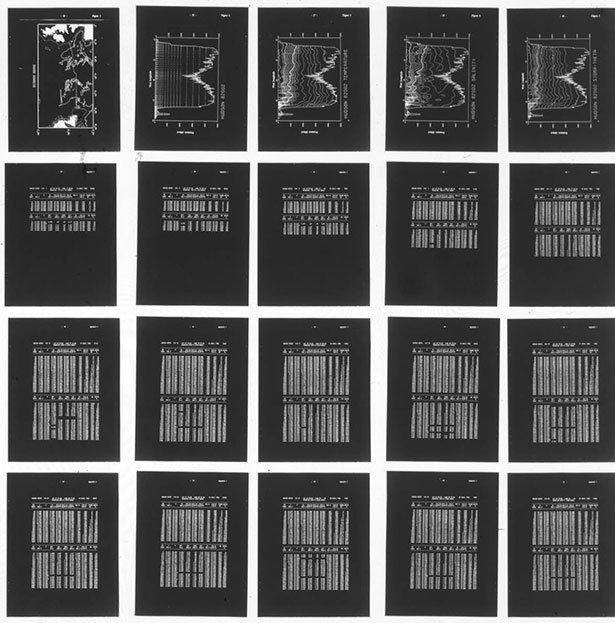
Wiedergeburt im Digitalzeitalter
Doch im Zuge der Archivierung erfährt der „Dinosaurier“ jetzt eine Wiedergeburt. Denn gegenüber digitalen Datenträgern hat der Mikrofilm gleich mehrere Vorteile. Weil Dokumente und Bilder 1:1 abgebildet werden, werden weder spezielle Hardware noch Software benötigt. Im Prinzip reichen eine Lichtquelle und eine Lupe oder Mikroskop zum Lesen der Information aus.
Viele Archive haben daher begonnen, auch rein digitale Daten zurück in den analogen Zustand zu versetzen und auf Mikrofilm zu konservieren. Digitale Dokumente, E-Mails, Internetseiten oder digitale Bilder werden dafür im Prinzip einfach abfotografiert und auf Film gebannt. Der große Vorteil: Einmal auf dem Mikrofilm gespeichert, halten die Daten mindestens 500 Jahre – die richtige Lagerung vorausgesetzt. Das ständige Umkopieren und Migrieren auf aktuelle Hard- und Software ist damit nicht mehr nötig.
Kulturerbe im Erzstollen
Ein Beispiel für ein Langzeitarchiv auf Mikrofilm-Basis ist der Barbarastollen in der Nähe von Freiburg. Hier, in einem ehemaligen Erzstollen, liegt der „Zentrale Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland“ – das wichtigste nationale Archiv unseres Landes. Als einziges Objekt in Deutschland ist es in die UNESCO-Liste der Haager Konvention eingetragen – einem Vertrag, der Kulturgut auch im Kriegsfall vor Zerstörung und Plünderung schützen soll.














