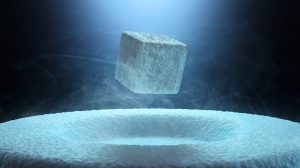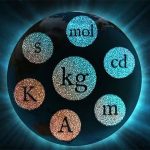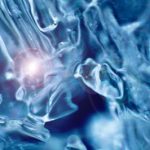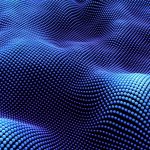Das Thermometer, wie es Daniel Fahrenheit vorgestellt hat, hat sich lange Zeit als Standard durchgesetzt. Diese Art der Temperaturmessung wird auch als Berührungsthermometer bezeichnet, da es in direktem Kontakt mit dem Medium, dessen Temperatur ermittelt werden soll, steht. Auch wenn das Grundprinzip ähnlich geblieben ist, haben sich im Laufe der Jahrhunderte einige Verbesserungen und Spezialformen von Berührungsthermometern herausgebildet.
Fahrenheits Thermometer funktionierte nach einem einfachen Prinzip: In einem von Glas umschlossenen Reservoir befindet sich Quecksilber. Wenn sich die Temperatur erhöht, dehnt sich das Quecksilber aus und steigt in einer Kapillare nach oben. Dort kann anhand einer Skala die Temperatur abgelesen werden. Wenn das Quecksilber wieder kälter wird, läuft es zurück in das Reservoir und auch die angezeigte Temperatur sinkt.

Probleme in der medizinischen Anwendung
Letzteres erwies sich in der frühen Medizin häufig als unpraktisch, da das Pflegepersonal zwar dafür zuständig war, die Temperatur der Patienten zu messen, das letztliche Ablesen des Thermometers aber in den Aufgabenbereich der Ärzte fiel. Da die Temperaturmessung mit den Thermometern des 18. und 19. Jahrhunderts zusätzlich noch recht lange dauerte, mussten diese bis zur Visite teilweise stundenlang beim oder sogar im Patienten bleiben.
Die erlösende Erfindung wird dem Tübinger Internisten Karl Ehrle um das Jahr 1868 zugeschrieben: Durch eine Verengung oberhalb des Quecksilberreservoirs kann sich das flüssige Metall bei Erwärmung zwar ungehindert ausdehnen, wenn die Umgebungstemperatur aber wieder sinkt, reißt der Quecksilberfaden ab und die angezeigte Temperatur ändert sich nicht. Um das Thermometer zurückzusetzen, muss das Quecksilber wieder zurück ins Reservoir geschüttelt werden – damit war das Fieberthermometer erfunden.