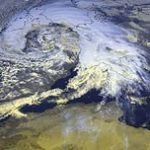Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelten sich die Azoren zu einem wichtigen Zentrum für den Walfang. Amerikanische Schiffe gingen hier auf Jagd, rekrutierten aber immer wieder auch große Teile ihrer Besatzung unter den mutigen Inselbewohnern. Die Azoreaner machten aber gleichermaßen auch in eigener Regie Jagd auf die Giganten der Meeres und nahmen vor allem die hier häufig vorkommenden Pottwale ins Visier.

Mit der Verlegung der ersten Transatlantik-Kabel in den 1880er und 1890er Jahren erlebten die Inseln einen weiteren kleinen Boom und entwickelten sich einem der wichtigsten Knotenpunkte der internationalen Kommunikation. Zahlreiche Unternehmen wie die Deutsch-Atlantische Telegrafengesellschaft oder die Western Union Telegraph Company siedelten sich auf Faial oder anderswo an und brachten ein bisschen Wohlstand auf die Inseln.
Später, Mitte des 20. Jahrhunderts, machten sich die Azoren schließlich einen Namen als Militärbasis und Stützpunkt für die alliierte Invasion in der Normandie während des zweiten Weltkriegs und als Tankstopp für Transatlantik-Flüge.
Das Klischee von den vergessenenen Inseln jedoch wurden die Azoren niemals los. Armut und mangelnde Perspektiven führten deshalb dazu, dass immer wieder Auswanderungswellen die Azoren heimsuchten. Gelegentlich war die „Republikflucht“ sogar so stark, dass ein Ausbluten der Inseln drohte. Vor allem Amerika war das gelobte Land. Heute leben in den USA drei bis vier mal so viele Azoreaner wie auf dem Archipel selbst.