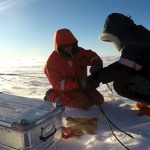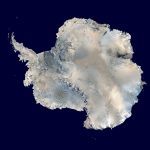Wenn das antarktische Schelfeis reißt, ist der Riss mit einer Mischung aus Eisbrocken, Schneeresten und matschigem, halbgefrorenem Meerwasser gefüllt – wie hier auf diesem Foto zu sehen. Diese Melange wirkt normalerweise wie ein Kleber und hält die Bruchkanten solange zusammen, bis die Lücke wieder zufriert. Doch bei großen Eisabbrüchen versagt dieser Kleber. Warum, haben nun Wissenschaftler geklärt.
Das Abbrechen großer Eisberge vom polaren Schelfeis ist ein ganz normaler Prozess – auch wenn dies in den letzten Jahren vermehrt vorzukommen scheint: In der Antarktis kalbte das Larsen-C-Schelfeis im Jahr 2017 einen Billion Tonnen schweren Eisberg, 2021 brachen große Stücke des Brunt-Schelfeises und des Ronne-Schelfeises ab. In der Arktis ging 2020 das letzte noch intakte Schelfeis Kanadas zu Bruch.
Warum bricht das Eis?
Aber warum? Während Risse im Eis durchaus häufig vorkommen und meist wieder heilen, ist bisher unklar, warum manche Risse so weit wachsen, bis das Schelfeis bricht. „Die vorherrschende Theorie hinter der Zunahme großer Kalbungsereignisse war bisher das Hydrofracturing: Schmelztümpel auf dem Eis lassen Wasser durch kleine Risse im Eis nach unten sickern und wenn dann dieses Wasser gefriert, dehnt es sich aus und sprengt das Eis weiter auf“, erklärt Eric Rignot von der University of California in Irvine.
Das Problem jedoch: „Diese Theorie kann nicht erklären, warum der Eisberg A68 vom Larsen-C-Schelfeis mitten im tiefsten antarktischen Winter abbrach, als keinerlei Schmelzwassertümpel vorhanden waren“, so Rignot. Auf der Suche nach einer Erklärung haben sich Rignot und sein Team daher elf von der Oberfläche bis zur Eisunterkante durchgehende Risse im Larsen-C-Schelfeis näher angeschaut.