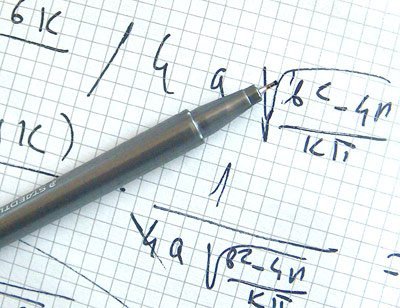Die Angst vor der nächsten Mathe-Arbeit kann echte Pein verursachen: Denn sie aktiviert Zentren im Gehirn, die normalerweise bei körperlichen Schmerzen reagieren. Das haben ein kanadischer und ein US-amerikanischer Forscher herausgefunden, als sie Menschen mit ausgeprägter Mathe-Angst vor und bei dem Lösen von Rechenaufgaben im Hirnscanner untersuchten. Das Ergebnis: Unmittelbar vor Beginn der Aufgaben wurden mehrere Hirnareale im Gehirn dieser Probanden aktiv, in denen Schmerzen, aber auch körperliche Bedrohungen verarbeitet werden. Bei Probanden, die Mathematik neutral gegenüberstanden, sei dies nicht der Fall gewesen, berichten die Forscher im Fachmagazin „PloS ONE“. Dieses Ergebnis zeige, dass die Angst vor Mathematik eine echte, körperliche Reaktion hervorrufen könne und eng mit dem Empfinden von Schmerzen verknüpft sei.
Mathematik fällt vielen Menschen nicht leicht, und auch in der Schule rangiert das Fach nicht gerade hoch auf der Beliebtheitsskala. Für einige Menschen jedoch sind Gleichungen und Textaufgaben der reinste Horror. „Diese Menschen empfinden extremen Stress, Angst und Bedrohung beim Gedanken an Mathematikaufgaben“, erklären Ian Lyons von der University of Chicago und Sian Beilock von der Western University in Ontario. Dass diese Mathe-Angst kein rein psychologisches Phänomen ist, sondern tatsächlich eine Form der körperlich empfundenen Beklemmung und des Schmerzes auslöst, zeigt nun ihr Experiment.
Nach Ansicht der Forscher könnte der neu entdeckte neuronale Mechanismus erklären, warum Menschen mit dieser Angst am liebsten allen Situationen aus dem Weg gehen, in denen sie möglicherweise mit Mathematik konfrontiert werden: „Schon die Angst vor diesem Fach tut ihnen weh, daher meiden sie Mathematik-lastige Fächer in der Schule und Berufswege, in denen sie etwas mit Gleichungen und Zahlen zu tun haben“, sagen die Wissenschaftler.
Zum Rechnen in den Hirnscanner
An der Studie nahmen 14 Menschen mit ausgeprägter Mathematik-Angst und 14 nicht-ängstliche Kontrollpersonen teil. Für den eigentlichen Test legten sich die Probanden in die Röhre eines Hirnscanners, der mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) ihre Hirnaktivität aufzeichnete. Auf einem Computerbildschirm vor ihnen erschienen währenddessen in zufälligem Wechsel Sprach- oder Mathematikaufgaben. „Entscheidend daran war, dass kurz vor jeder Aufgabe ein farbiger Kreis anzeigte, ob eine Mathematik- oder eine Sprachaufgabe folgen würde“, erklären die Forscher. Dadurch konnten sie vergleichen, ob die Probanden schon in der Erwartungsphase unterschiedlich reagierten.