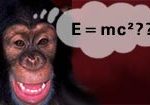Dass Hunde eifersüchtig sein können, ist für viele Hundebesitzer nichts Neues. Ob dieses Verhalten aber tatsächlich mit unserer menschlichen Eifersucht vergleichbar ist, war bisher strittig. Jetzt haben zwei US-Forscherinnen dies in einem Experiment überprüft. Ihr Ergebnis: Hunde zeigen sehr wohl eine spezifische Eifersucht. Dieses Gefühl hat demnach tiefere evolutionäre Wurzeln als einige Forscher glaubten.
In Beziehungen ist sie häufig, aber auch schon sechs Monate alte Säuglinge zeigen bereits Eifersucht, wenn ihre Mutter sich mit einem anderen Kleinkind beschäftigt. Woher dieses Gefühl kommt und wann es entstand, ist bisher allerdings strittig, wie Christine Harris und Caroline Prouvost von der University of California in San Diego berichten. So gehen einige Psychologen davon aus, dass für eine echte Eifersucht höhere geistige Fähigkeiten nötig sind: Der Eifersüchtige muss erkennen und interpretieren können, was der „Eindringling“ für seine Beziehung bedeutet und sich in die anderen beiden Akteure hinein versetzen können.
Andere dagegen gehen davon aus, dass Eifersucht zumindest im Kern ein sehr viel simpleres, primitiveres Gefühl ist, ähnlich wie Angst und Aggression. Dieses könnte sich schon bei Tieren im Zusammenhang mit der Eltern-Kind-Beziehung und der Geschwisterrivalität entwickelt haben. Tatsächlich war auch schon Charles Darwin der Ansicht, dass auch Tiere Eifersucht empfinden und zeigen können. Und fast jeder Hundebesitzer wird bei seinem Liebling vermutlich schon eifersüchtiges Verhalten beobachtet haben.
Plüschhund als Rivale
Wissenschaftliche Studien zu diesem Thema fehlten bei Hunden jedoch bisher. Harris und Prouvost holten dies nun nach. Dafür führten sie mit 36 Hunden und ihren Besitzern ein kleines Experiment durch – verrieten den Besitzern aber nicht, worum es eigentlich ging. Diese sollten sich auf den Boden setzen und ein animierter Plüschhund wurde neben sie gestellt. Auf Knopfdruck begann dieser zu wedeln und einige Sekunden lang zu bellen.
Die Hundebesitzer sollten nun mit diesem Plüschhund interagieren, als wäre es ihr eigener: Mit ihm reden, ihn streicheln und loben. Den eigenen Hund sollten sie dabei komplett ignorieren. In zwei weiteren Durchgängen „spielte“ das Herrschen oder Frauchen statt mit dem Plüschhund mit einem ausgehöhlten Kürbis – einem für die Hunde völlig fremden Objekt. Und im Kontrolldurchgang lasen die Besitzer einfach nur laut aus einem Kinderbuch vor.
Stupsen, drängeln, schnappen
Das Ergebnis war eindeutig: Spielte Frauchen oder Herrchen mit dem Plüschhund statt mit ihnen, reagierten die Hunde alles andere als begeistert: 78 Prozent von ihnen stupsten oder berührten ihren Besitzer immer wieder und versuchten, sich zwischen Plüschhund und Mensch zu drängen. Ein Viertel der Hunde schnappte sogar nach dem vermeintlichen Rivalen, wie die Forscher berichten. Bei Kürbis und Buch war dies dagegen nicht der Fall.
„Das deutet darauf, dass die Hunde nicht nur eifersüchtiges Verhalten zeigen, sondern dass sie auch versuchen, die Verbindung zwischen ihrem Besitzer und dem vermeintlichen Rivalen aufzubrechen“, erklärt Harris. Interessanterweise schien die Mehrheit der Hunde den Plüschtier tatsächlich für einen Artgenossen zu halten, denn immerhin 86 Prozent von ihnen schnüffelte im Laufe des Experiments an dessen Hinterteil – ein Verhalten, dass sie auch bei einem echten Artgenossen zeigen würden.
Gefühl mit tiefen Wurzeln
Nach Ansicht der Forscher ist dies ein starkes Indiz dafür, dass auch Haushunde eine Form der Eifersucht kennen. Jedes einzelne der beobachteten Verhaltensweisen allein wäre vielleicht nicht unbedingt ein Indiz, wie die erklären. Aber ihre Kombination ähnelt sehr stark dem Verhaltensmuster von eifersüchtigen Menschen.
„Wir wissen natürlich nicht, welche subjektiven Erfahrungen der Hundes dabei durchlebt, aber es sieht so aus, als wenn er versucht, eine ihm wichtige soziale Beziehung zu schützen“, sagt Harris. Und die gleiche Motivation stecke auch hinter der Eifersucht beim Menschen. Ihrer Meinung nach Eifersucht daher kein soziales, vom Menschen erfundenes Konstrukt, sondern ein Gefühl, dass ähnlich tief in uns verwurzelt sein könnte wie die Angst. (PLOS ONE, 2014; doi: 10.1371/journal.pone.0094597)
(University of California – San Diego, 24.07.2014 – NPO)