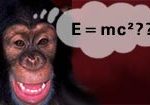„Charaktertest“ für Karpfen
Am Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und der Humboldt-Universität zu Berlin hat ein Team um Thomas Klefoth und Robert Arlinghaus am Beispiel des Karpfens Cyprinus carpio nun einen etablierten „Charaktertest“ zur Bewertung der Kühnheit und Risikobereitschaft von Fischen auf den Prüfstand gestellt.
Die Verhaltensforscher führten in ihrer neuen Studie identische Versuchsreihen mit zwei genetisch unterschiedlichen Karpfenrassen sowohl in naturnahen Teichen als auch in großen Labortanks durch. Das Ergebnis: Im Teich benahmen sich die Tiere wie erwartet gemäß ihrem genetisch bedingten Temperament – während die dreisten Spiegelkarpfen stets hohe Risiken bei der Futtersuche eingingen, blieben die schüchternen Schuppenkarpfen so lange wie möglich im Versteck.
Verhalten nicht berechenbar
Im Labor verhielten sich die Tiere jedoch nach Angaben der Forscher unberechenbar. Erst als dort eine Gefahrenquelle hinzugefügt wurde – auf vorher ungefährlichen Futterplätzen gingen die Forscher plötzlich mit einer Miniangel auf Fischfang – fielen die Fische in ihre typischen Verhaltensmuster zurück: Der Spiegelkarpfen kühn, der Schuppenkarpfen scheu.
Bislang bevorzugen viele Verhaltensforscher in Studien zur Fischpersönlichkeit Laborexperimente, um so mögliche Störquellen auszuschalten und unverzerrte Ergebnisse zu erlangen. Die nun vorgelegten Ergebnisse zeigten den Wissenschaftlern zufolge aber, dass es manchmal genau dieser Störungen bedarf, damit die Tiere ihr wahres Gesicht zeigen.

Schuppenkarpfen haben viele Schuppen und sind der ursprünglichen Wildform ähnlicher. Dieser ging IGB-Mitarbeitern ins Netz. © IGB / Besatzfisch
Zwei Zuchtformen untersucht
Bei dem Versuch arbeiteten die Forscher mit zwei verschiedenen Zuchtformen des Karpfens, die alle gemeinsam in der gleichen Umwelt geboren und aufgewachsen waren. Während der Schuppenkarpfen der ursprünglichen Wildform von Cyprinus carpio ähnelt und von seiner genetischen Ausstattung zu vorsichtigem Verhalten neigen sollte, ist der Spiegelkarpfen stark domestiziert und unter Anglern und Fischzüchtern für sein mutiges, „unbekümmertes“ Benehmen bekannt.
Um die eigentlich erwarteten Verhaltensunterschiede nachzuweisen, bauten die Forscher sowohl im Freiland als auch im Labor das gleiche Experiment auf. In Teichen und in einem ähnlich dimensionierten Großaquarium installierten sie einen sicheren Unterschlupf und zwei offene Futterstellen, die für die Fische nur durch die Passage einer freien Fläche zu erreichen waren. Ungeschützte Gebiete bergen zumindest theoretisch vielerlei Risiken, so dass nur die mutigsten Tiere die Freifläche regelmäßig durchqueren sollten.
Risikobereitschaft der Versuchstiere ermittelt
Die Risikobereitschaft der Versuchstiere ermittelten die Forscher, indem sie maßen, wie viel Zeit die Fische außerhalb des sicheren Unterschlupfes verbrachten und wie häufig sie die Futterstellen aufsuchten. Tatsächlich besuchten die Spiegelkarpfen im Freilandversuch die Futterplätze signifikant häufiger als die Schuppenkarpfen. Im Labor konnte dieser Unterschied zur Überraschung der Wissenschaftler zunächst nicht nachgewiesen werden.
Im nächsten Versuchsschritt imitierten die Biologen dann auf schonende Art eine Gefahrenquelle an den Futterplätzen, indem sie einige der Leckerbissen mit Angelhaken versahen und alle gefangenen Fische nach dem Fang wieder vorsichtig in das Wasser zurücksetzten. In Anbetracht dieser latenten Bedrohung legten die beiden Karpfenrassen schließlich auch im Labor ihre angeborenen Verhaltensmuster an den Tag, so die Forscher.
Allgegenwärtige Gefahr
Für den unterschiedlichen Ausgang der beiden Experimente haben diese folgende Erklärung: Bei dem naturnahen Versuch im Freiland wurden die Teiche mit Wasser eines großen Natursees geflutet. Gerüche von Raubfischen aus dem See und die ständige Gefahr von Reihern ergriffen zu werden, waren hier allgegenwärtig.
Die Schuppenkarpfen folgten nach Ansicht der Wissenschaftler ihren genetisch fixierten Instinkten und blieben lieber so lange wie möglich in ihrem Versteck. Die Spiegelkarpfen hingegen eroberten die ungeschützten Futtergebiete entsprechend ihrer ungestümen Haustiermanier.
Beangelung macht „Schuppis“ zurückhaltender
Im Labor wurden die Versuchsbecken in einer abgeschirmten Halle mit Leitungswasser versorgt. Von Feinden oder gefährlichen Gerüchen zunächst keine Spur. Unter diesen Umständen fühlten sich auch die eher scheuen Schuppenkarpfen nicht gehindert, den Unterschlupf zu verlassen und schlugen dann ebenso beherzt wie die Spiegelkarpfen an den Futterstellen zu. Als sich das Fressen durch die Beangelung zunehmend gefährlicher gestaltete, wurden die „Schuppis“ jedoch wieder zurückhaltender und zogen sich in den Unterstand zurück, so die Biologen.
Zur Aufdeckung von genetisch veranlagten Temperamentunterschieden eignen sich die wirklichkeitsnäheren Freilandversuche demnach besser als klassische Laborversuche, weil die Fische in Teichen ihre Temperamentunterschiede jederzeit auslebten. Laborstudien müssen der nun vorliegenden Untersuchungen zufolge jedoch mindestens eine Gefahrenquelle beinhalten, um adäquate Aussagen zu genetischen Hintergründen von Kühnheit und Risikobereitschaft von Fischen treffen zu können. (Behavioral Ecology and Sociobiology, 2012; DOI: 10.1007/s00265-011-1303-2)
(Forschungsverbund Berlin, 23.02.2012 – DLO)
23. Februar 2012