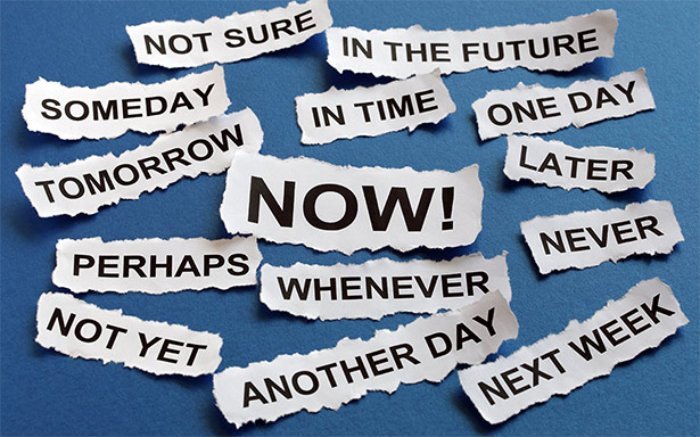Morgen ist auch noch ein Tag: Wer getreu dieses Mottos immer wieder Aufgaben aufschiebt, kann künftig seinen Genen die Schuld geben – zumindest als Frau. Denn wie eine Studie offenbart, lässt sich der Hang zum Prokrastinieren beim weiblichen Geschlecht an der Ausprägung eines bestimmten Gens ablesen. Dieser DNA-Abschnitt beeinflusst die Konzentration des Botenstoffs Dopamin im Gehirn: Je höher der Dopaminspiegel, desto eher neigen Frauen zum Aufschieben.
Manche Menschen arbeiten ihre To-do-Liste lieber schnell ab, andere schieben unangenehme Aufgaben immer wieder vor sich her. Diese „Aufschieberitis“ kann im Extremfall so weit gehen, dass sie das Privat- und Berufsleben der Betroffenen beeinträchtigt. Doch wie lässt sich die Neigung zum Prokrastinieren erklären? Studien legen nahe, dass unter anderem die Gehirnanatomie eine Rolle spielt. So lässt sich der Hang zum Aufschieben an der Größe und Verknüpfung zweier Hirnareale ablesen.
Botenstoff Dopamin im Fokus
Caroline Schlüter von der Ruhr-Universität Bochum und ihre Kollegen haben nun untersucht, ob möglicherweise auch noch andere Faktoren an der „Aufschieberitis“ beteiligt sind. „Ob wir Ziele direkt angehen anstatt sie aufzuschieben, hängt entscheidend von unserer Fähigkeit ab, bestimmte kognitive und emotionale Kontrollmechanismen zu initiieren. Diese Metakontrollmechanismen wurden in der Vergangenheit immer wieder mit Dopamin-Signalwegen in Verbindung gebracht“, erklären sie.
Die Forscher fragten sich daher: Könnten genetisch bedingte Unterschiede des Dopamin-Systems mit der Neigung zum Prokrastinieren in Zusammenhang stehen? Um dies herauszufinden, analysierten Schlüter und ihr Team genetische Daten von 278 Männern und Frauen. Dabei interessierte sie vor allem das sogenannte Tyrosinhydroxylase-Gen. Denn je nach Ausprägung dieses Gens finden sich im Gehirn mehr oder weniger Botenstoffe aus der Katecholamin-Familie, zu denen auch das „Glückshormon“ Dopamin gehört.
Erhöhte Ablenkbarkeit
Zusätzlich erfassten die Wissenschaftler mithilfe eines Fragebogens, wie gut die Teilnehmer ihre Handlungen kontrollieren können – ein Indiz für den Hang zum Aufschieben. Die Ergebnisse offenbarten: Frauen mit schlechterer Handlungskontrolle hatten die genetische Veranlagung für einen höheren Dopaminspiegel.
Wie Schlüter und ihr Team berichten, gehen höhere Dopaminkonzentrationen oftmals mit einer erhöhten kognitiven Flexibilität einher. „Das ist nicht grundsätzlich schlecht, ist aber häufig mit einer erhöhten Ablenkbarkeit verbunden“, sagt Schlüters Kollege Erhan Genç. „Wir nehmen an, dass es dadurch schwerer wird, eine einmal gefasste Handlungsabsicht aufrechtzuerhalten“, ergänzt Schlüter. Betroffene Frauen könnten demnach eher zum Aufschieben neigen, weil sie sich stärker von Störfaktoren ablenken lassen.
Was ist bei Männern anders?
Interessanterweise zeigte sich der bei den weiblichen Probanden beobachtete Zusammenhang bei den Männern nicht. Wie kann das sein? Auch frühere Studien haben den Forschern zufolge bereits geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen der Ausprägung des Tyrosinhydroxylase-Gens und dem Verhalten enthüllt. „Der Zusammenhang ist noch nicht vollständig geklärt, aber das weibliche Sexualhormon Östrogen scheint eine Rolle zu spielen“, berichtet Genç.
So beeinflusst Östrogen indirekt die Dopamin-Produktion im Gehirn und erhöht die Anzahl bestimmter Nervenzellen, die auf Signale dieses Botenstoffes reagieren. „Frauen könnten demnach aufgrund des Östrogens empfänglicher für die genetisch bedingten Unterschiede im Dopaminlevel sein, was sich wiederum im Verhalten niederschlägt“, so der Biopsychologe.
Unabhängig von der Hirnanatomie
In Zukunft wollen die Wissenschaftler die Rolle des Östrogenspiegels für die „Aufschieberitis“ genauer erforschen und außerdem untersuchen, ob auch Botenstoffe wie Noradrenalin an diesem Phänomen beteiligt sind – die Ausschüttung dieser Substanz wird ebenfalls durch das Tyrosinhydroxylase-Gen beeinflusst.
Klar ist schon jetzt: Nicht nur die Gehirnanatomie, sondern auch die Gene beeinflussen unseren Hang zum Prokrastinieren. Wie die Forscher betonen, hing die Ausprägung des Tyrosinhydroxylase-Gens bei ihrer Untersuchung nicht mit der Größe und Verknüpfung der zuvor in diesem Kontext identifizierten Hirnregionen zusammen. „Damit legt unsere Studie nahe, dass genetische, anatomische und funktionelle Unterschiede dieses Persönlichkeitsmerkmal unabhängig voneinander beeinflussen“, so ihr Fazit. (Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2019; doi: 10.1093/scan/nsz049)
Quelle: Ruhr-Universität Bochum