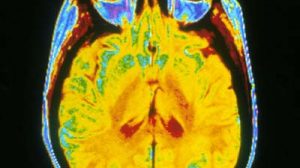Das Prinzip des „Pay-What-You-Want“ – also „zahle, was Du willst“ – animiert Kunden nicht immer zu mehr Konsum: Unter bestimmten Umständen greifen mehr Menschen zu, wenn ein Angebot einen festgesetzten günstigen Preis hat, als wenn sie den Preis selbst bestimmen dürfen. Das hat ein internationales Forscherteam, zu dem auch der Wirtschaftswissenschaftler Gerhard Riener von der Universität Düsseldorf gehörte, beobachtet. Besonders ausgeprägt ist der Effekt, wenn die potenziellen Kunden das Gefühl haben, dass das Angebot relativ wertvoll ist – sie aber nicht bereit sind, viel Geld auszugeben. In solchen Fällen verzichten sie eher komplett auf den Kauf, als einen ihnen unfair erscheinenden geringen Betrag dafür zu geben. Treibende Kraft dahinter ist das Bestreben, ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt „PNAS“.
{1l}
Bei Pay-What-You-Want-Angeboten, kurz PWYW, kann der Kunde völlig frei über den Preis für eine Ware oder eine Dienstleistung entscheiden. Auch wenn es die Anbieter nicht immer schaffen, mit dem Bezahlsystem ihre Kosten zu decken, gibt durchaus Fälle, in denen PWYW bereits seit Jahren funktioniert. Für Wirtschaftspsychologen stellt sich dabei vor allem eine Frage: Warum geben Menschen Geld für etwas aus, das sie auch umsonst haben könnten? Denn die wenigsten Kunden von PWYW-Angeboten entscheiden sich dafür, gar nichts zu bezahlen. Um eine Antwort zu finden, untersuchten Riener und seine Kollegen nun drei Situationen mit leicht unterschiedlichen PWYW-Strategien.
Wer mehr bekommt, zahlt mehr – oder gar nicht
Im ersten Fall beobachteten die Forscher über 50.000 Menschen in einem Freizeitpark, die nach einer Achterbahnfahrt die Möglichkeit erhielten, ein von ihnen geschossenes Foto für einen selbstgewählten Preis zu kaufen. Ein Teil der Besucher bekam die Zusatzinformation, dass die Hälfte des Geldes an eine bekannte Wohltätigkeitsorganisation gespendet würde, die sich um kranke Kinder kümmert.