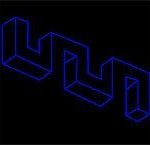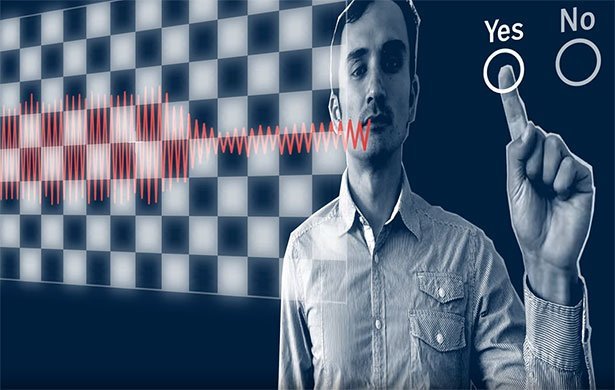Alle Teilnehmer blickten auf einen Bildschirm, auf dem jeweils kurz ein Schachbrett aufblitzte. Parallel dazu erklang ein eine Sekunde langer Ton – aber nicht immer: Anfangs war das Schachbrett immer vom Ton begleitet, später war der Ton mal leiser und mal gar nicht vorhanden. Immer wenn die Probanden glaubten, den Ton zu hören, sollten sie einen Knopf drücken – umso länger, je sicherer sie sich waren. Während des Versuchs zeichneten die Forscher die Hirnaktivität der Probanden mittels funktioneller Magnetresonanz-Tomografie (fMRT) auf.
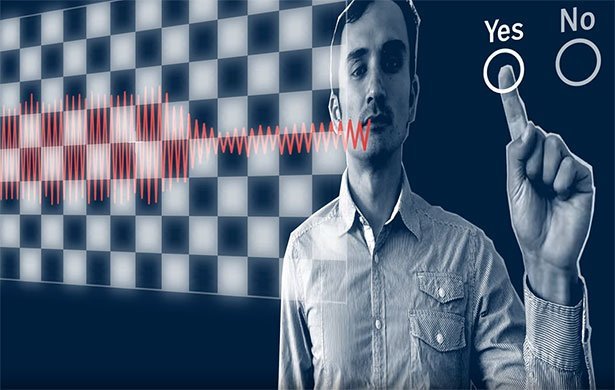
Ist ein Ton zu hören oder nicht? © Science Magazine
Gehirn ausgetrickst
Das Ergebnis: Die anfangs ständige Kombination von Schachbrett und Ton erzeugte bei nahezu allen Probanden sogenannte konditionierte Halluzinationen: Sie glaubten nach einer Weile, selbst dann einen Ton zu hören, wenn gar keiner erklang. Der Grund dafür: Weil anfangs beide Reize immer gemeinsam auftreten, lernt das Gehirn dies und erwartet deshalb diese Kombination.
„Man nimmt dann das war, was man erwartet und nicht das, was unsere Sinne uns eigentlich sagen“, erklärt Powers. Anders ausgedrückt: Die Verarbeitungskette im Gehirn kombiniert den visuellen Reiz mit der Erwartung des akustischen. Weil vermeintlich zum Schachbrett immer ein Ton gehört, ergänzt unser Gehirn diesen selbst dann, wenn er in Wirklichkeit ausbleibt.
Bei Stimmenhörern fünfmal häufiger
Das Spannende aber: Nicht alle Probanden waren gleichermaßen anfällig für diese konditionierte Halluzination. Bei den schon vorher regelmäßig stimmenhörenden Teilnehmern traten diese akustischen Halluzinationen fünfmal häufiger auf. Sie waren sich auch um 28 Prozent sicherer, dass die Töne wirklich da waren.
Die gesunden Probanden ohne Halluzinations-Vorgeschichte jedoch merkten in der zweiten Hälfte des Versuchs, dass das akustische Signal immer häufiger fehlte. Sie drückten daher seltener den „Ja“-Knopf und waren sich auch insgesamt unsicherer, ob sie einen Ton gehört hatten oder nicht.
Erwartungen behalten die Oberhand
Genau dies könnte erklären, warum einige Menschen anfälliger für Halluzinationen sind: Normalerweise ist unser Gehirn dazu in der Lage, einmal angelegte Erwartungen wieder zu verändern. Es überprüft sie ständig anhand der aktuellen Sinneserfahrungen. Passen Erwartung und Reize nicht mehr zusammen, passt es seine Erwartungen entsprechend an.
Nicht so bei Menschen mit Psychosen oder gesunden Menschen, die zu Halluzinationen neigen: Hier funktioniert die Überprüfung der Erwartungen schlechter. Ihr Gehirn bewertet die intern gespeicherten Erwartungen meist stärker als die Sinnesreize von außen. „Dieses Ungleichgewicht zwischen Erwartung und Sinnesreiz kann dann die Halluzinationen erzeugen“, so Powers.
Wie das Experiment ablief und was sich dabei über Halluzinationen und das Gehirn zeigte© Science Magazine
Kleinhirn als „Halluzinations-Wächter“
Belege für diesen Zusammenhang von überstabilen Erwartungen und Halluzinationen fanden die Wissenschaftler auch in den Hirnscans: Je häufiger und stabiler die Probanden die konditionierten Halluzinationen hatten, desto weniger aktiv war ihr Kleinhirn. Diese jedoch spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Koordination von Bewegungen und muss daher ständig seine Informationen mit den Sinnesreizen von außen abgleichen, wie die Forscher erklären.
Bei Menschen mit Psychosen jedoch und Menschen, die zu Halluzinationen neigen, ist dieser Abgleich gehemmt und ihr Kleinhirn ist daher weniger aktiv. „Dies spricht dafür, dass das Cerebellum einer der entscheidenden Wachposten gegen solche fehlerhaften Wahrnehmungen ist“, sagt Powers.
Noch ein weiteres Hirnareal reagierte bei den „Stimmenhörern“ abweichend: der Hippocampus. Er gleicht normalerweise Sinnesreize mit Erinnerungen und Erfahrungen ab. Auch dieses Hirnareal spielt daher bei der Überprüfung der Vorannahmen eine Rolle, wie die Forscher erklären. Im Experiment war die Aktivität im Hippocampus um so höher, je unsicherer sich die Probanden waren, den Ton gehört zu haben.
Hilfe bei Früherkennung und Therapie
Damit liefert dieses Experiment wertvolle Einblicke in die Mechanismen, die Halluzinationen hervorrufen – und die einige Menschen besonders anfällig für dieses Phänomen machen. Wie Powers und seine Kollegen erklären, könnten diese Erkenntnisse eines Tages dabei helfen, anfällige Personen früher zu identifizieren.
Gleichzeitig könnte das Wissen um die beteiligten Hirnregionen vielleicht sogar dazu führen, gezielte Therapien gegen das Stimmenhören zu entwickeln. (Science, 2017; doi: 10.1126/science.aan3458)
(Science, 14.08.2017 – NPO)
14. August 2017