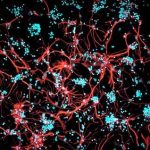Jeder Sechste leidet unter Depressionen
Etwa 16 Prozent der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens an einer Depression. Neben dramatischen Folgen für das private wie auch berufliche Leben der Betroffenen bergen Depressionen nachweislich weitere gesundheitliche Risiken. Schon frühere Studien haben gezeigt, dass Depressive häufiger Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln.
Dass depressive Menschen auch ein höheres Risiko tragen, einen Schlaganfall zu erleiden, war bisher unklar. Mit jährlich mehr als 250.000 Fällen zählt auch der Schlaganfall in Deutschland zu den Volkskrankheiten. Deshalb sind die Ergebnisse von Pan und seinen Kollegen nicht nur medizinisch, sondern auch ökonomisch bedeutsam für das Gesundheitssystem.
Metaanalyse liefert neue Ergebnisse
Um dem Schlaganfallrisiko von Depressionskranken auf den Grund zu gehen, führten die Forscher eine Metaanalyse durch. Hierzu verwendeten sie Daten von insgesamt 317.540 Menschen aus 28 prospektiven Bevölkerungsstudien. Zu Beginn untersuchten Ärzte die Probanden auf depressive Symptome und betreuten sie in der Folge noch bis zu 29 Jahre lang. In diesem Zeitraum erlitten 8.478 Studienteilnehmer einen Schlaganfall.
Die Daten zeigen nach Angaben der Wissenschaftler, dass Depressive ein um 45 Prozent höheres Risiko haben, einen Hirnschlag zu erleiden. Ihr Risiko an einem Schlaganfall zu versterben, lag sogar um 55 Prozent höher als bei psychisch Gesunden.
„Legt man unsere Zahlen zugrunde, sind etwa vier Prozent aller Schlaganfälle in den USA auf eine Depression zurückzuführen“, machen die Forscher die Bedeutung ihrer Ergebnisse deutlich. Hochgerechnet auf Deutschland wären dies 10.000 Schlaganfälle jährlich. Bei genaueren Untersuchungen der Wissenschaftler stellte sich heraus, dass Depressive vor allem häufiger einen so genannten ischämischen Hirninfarkt – nicht eine Hirnblutung – bekamen.
Hormone könnten Schlaganfallrisiko erhöhen
Nach Meinung von Pan und seinen Kollegen gibt es verschiedene Mechanismen, die diesen Zusammenhang erklären könnten: Zum einen ist bereits bekannt, dass Depressionen den Hormonhaushalt des Menschen beeinflussen und Entzündungen verstärken können. So findet man bei Depressiven höhere Blutspiegel für Entzündungsfaktoren wie CRP, IL-1 und IL-6, die nachweislich zu einem höheren Schlaganfallrisiko führen können.
Menschen mit Depressionen leben ungesünder
Darüber hinaus vernachlässigen Depressive eher ihre Gesundheit. Studien haben gezeigt, dass depressive Menschen häufiger rauchen, sich körperlich weniger betätigen und schlechter ernähren. Diese Faktoren und die daraus entstehenden Folgeerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck könnten für das erhöhte Schlaganfallrisiko von Depressiven mitverantwortlich sein.
Zudem geben die Forscher zu bedenken, dass auch die Einnahme von Antidepressiva mit einem höheren Risiko für einen Schlaganfall verbunden war. Ob die Medikation selbst oder die damit einhergehende Schwere der Depression das Risiko erhöhe, sei aber bisher unklar. Deshalb fordert Pan weitere Studien: „Wir müssen die zugrundeliegenden Mechanismen genauer untersuchen, um den Zusammenhang zwischen Depression und Schlaganfall besser zu verstehen.“
(Deutsche Gesellschaft für Neurologie, 29.11.2011 – DLO)
29. November 2011