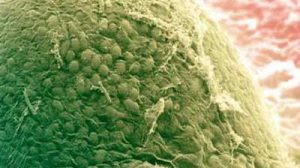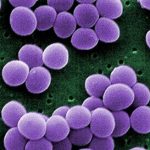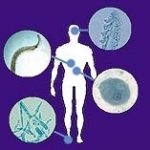Fischfutter als Überträger?
Der Verdacht der Forscher: Könnten diese Antibiotika-Resistenzen durch das Fischfutter übertragen worden sein? Meist bestehen diese proteinreichen Pellets entweder aus Überresten von Schlachttieren wie Knochenmehl, Proteinextrakten oder Fleischresten oder aber aus Fischmehl. Die tierischen Rohstoffe werden getrocknet, erhitzt und dann fein gemahlen und zu Pellets gepresst.
Ob diese Pellets womöglich resistente Bakterien oder Antibiotika-Rückstände aus den Herkunftstieren enthalten, ist jedoch bislang nie systematisch untersucht worden. Deshalb haben die Forscher nun fünf gängige Fischmehl-Futter und zwei aus Landtierproteinen produzierte Fischfutter untersucht. Sie prüften dabei sowohl auf Antibiotika-Rückstände als auch auf Resistenzgene von Bakterien.

Fischfutter-Automat in einer Lachs-Farm in Finnland. © Plenz/CC-by-sa 3.0
Antibiotika-Reste in allen Proben
Das Ergebnis: „Von den getesteten 23 Antibiotika haben wir 14 in den Fischmehlen detektiert“, berichten Wang und seine Kollegen. „In jeder Fischmehl-Probe haben wir zwischen sechs und elf verschiedene Antibiotika nachgewiesen.“ Am häufigsten waren dabei Antibiotika aus der Klasse der Sulfonamide und Fluorquinolone: Sie waren in allen Proben enthalten.
Die Konzentrationen reichten dabei von 16,3 bis zu 54 Mikrogramm pro Kilogramm. Das liegt zwar deutlich unter den Grenzwerten, die für Antibiotika-Rückstände in Lebensmitteln gelten – in Milch dürfen beispielsweise 100 Mikrogramm pro Kilogramm enthalten sein. Doch gerade der Kontakt von Bakterien mit geringen Antibiotika-Mengen gilt als besonders resistenzfördernd, weil dann diejenigen überleben und sich vermehren, die gut gegen die Mittel gewappnet sind.
Mehr als hundert Resistenzgene
Aber das war noch nicht alles: Das Fischfutter enthielt auch überraschend viele Resistenzgene – ein Hinweis darauf, dass bereits zahlreiche resistente Bakterien in den tierischen Ausgangsmaterialien vorhanden waren. In den fünf Fischmehl-Proben wiesen die Forscher 1342 verschiedene Antibiotika-Resistenzgene nach, in den beiden Tiermehlen fanden sie 74 und 1165 Resistenzgene.
„Die drei von diesen Genen am häufigsten vermittelten Resistenzen bestanden gegen Tetrazykline, Beta-Laktam-Antibiotika und auch in elf bis 21 Prozent gegen multiple Wirkstoffe“, berichten Wang und seine Kollegen. Offenbar reicht selbst das Erhitzen und Zerkleinern der Fisch- und Tiermehle nicht aus, um diese Gene zu zerstören. „Das Fischmehl ist damit ein bisher unerkanntes Reservoir von Antibiotika-Resistenzgenen“, so die Forscher.
Vom Fischfutter in die Nahrungskette
Das aber bedeutet: Durch das Fischfutter der Aquakulturen gelangen weltweit große Mengen sowohl von Antibiotika als auch von Resistenzgenen in die Meeresumwelt. „Weniger als 35 Prozent des Fischfutters wird in diesen Anlagen von den Fischen gefressen, der Rest sinkt zu Boden und wird so freigesetzt“, sagen die Wissenschaftler. Über die Fische, aber auch durch die Bakterien im Sediment können diese Gene dann bis in die Nahrungskette gelangen.
Dass die Resistenzgene aus dem Fischfutter von Meeresboden-Bakterien aufgenommen werden, belegen Experimente in einer Versuchsanlage in China. Die anfänglich in den Sedimenten nachgewiesenen Resistenzgen-Mengen stiegen schon wenige Tage nach einer Berieselung mit Fischmehl um das Zwei- bis Fünffache an. „Das mexF-Gen, das eine Multiresistenz gegen Chloramphenikole und Fluorquinolone vermittelt, erhöhte sich am dritten Tag sogar um das 106-Fache“, berichten die Forscher.
Futterproduktion und Fütterung müssen angepasst werden
Damit scheint klar, dass das in Aquakulturen eingesetzte Fischfutter mit dazu beiträgt, dass sich Antibiotika-Resistenzen in der Meeresumwelt ausbreiten. Doch auch an Land werden Fisch- und Tiermehle als Futtermittel und Dünger genutzt – hier seien daher dringend weitere Untersuchungen nötig, sagen die Forscher. Ihrer Ansicht nach sollten Tiermehle künftig bei Kontrollen auch gezielt auf Antibiotika und Antibiotika-Resistenzgene hin untersucht werden.
Die Wissenschaftler empfehlen zudem, Methoden zu entwickeln, mit denen DNA und Resistenzgene bei der Futterproduktion effektiver zerstört werden als bisher der Fall. „Um die weitere Ausbreitung solcher Gene zu unterbinden, sollten zudem die Futterstrategien in den Aquakulturen angepasst werden, damit nicht so viel überschüssiges Fischmehl in die Umwelt gelangt“, sagen Wang und seine Kollegen. (Environmental Science & Technology, 2017; doi: 10.1021/acs.est.7b02875)
(American Chemical Society, 31.08.2017 – NPO)
31. August 2017