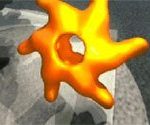Die Anfälligkeit gegenüber einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) ist möglicherweise erblich. Denn ob ein Kriegseinsatz oder eine andere traumatische Erfahrung schwere psychische Folgen hinterlässt, hängt auch von den Genen ab, wie US-amerikanische Forscher festgestellt haben. Sie entdeckten zwei Genvarianten, die Menschen anfälliger für eine Posttraumatische Belastungsstörung machen. Betroffene einer solchen Störung leiden an Depressionen, Schlafstörungen und erleben häufig quälend realistische Alpträume.
Die jetzt entdeckten Mutationen könnten erklären, warum nur einige Menschen nach einer traumatischen Erfahrung an einer PTSD erkranken. „Unsere Ergebnisse könnten auch dabei helfen, neue Möglichkeiten der Vorbeugung und Behandlung der PTSD zu entwickeln“, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin „Journal of Affective Disorders“.
Entdeckt haben die Forscher die Genvarianten, als sie die DNA von 200 Armeniern analysierten, die 1988 ein schweres Erdbeben überlebt hatten. Diejenigen, bei denen zwei Gene, TPH1 und TPH2 verändert waren, litten hinterher häufiger unter den typischen Symptomen einer Posttraumatischen Belastungsstörung, wie die Forscher berichten. Diese Anfälligkeit sei gehäuft in einigen Familien aufgetreten und daher wahrscheinlich vererbbar.
Veränderte Gene lösen Mangel an Glückshormon aus
Die von der Mutation betroffenen Gene kontrollieren die Produktion des Hirnbotenstoffs Serotonin, wie die Forscher berichten. Dieser Botenstoff gilt als Glückshormon, da er die Stimmung positiv beeinflusst. Menschen mit Depressionen und anderen Symptomen einer PTSD haben oft einen zu niedrigen Serotoninspiegel.
„Wir vermuten, dass die veränderten Gene weniger Serotonin produzieren“, sagt Erstautor Armen Goenjian von der University of California in Los Angeles. Betroffene seien deshalb nach einer Gewalterfahrung oder einer Naturkatastrophe anfälliger für eine PTSD.
Bessere Basis für Diagnose und Therapie
Nach Ansicht der Forscher kann die Entdeckung der Genvarianten dazu beitragen, die PTSD eindeutiger und besser zu diagnostizieren. Denn bisher beruhe die Diagnose nur auf den Symptomen. Zukünftig könnten Neurologen und Psychiater die Krankheit auch anhand der biologisch-genetischen Veränderungen im Gehirn erkennen. „Unsere Ergebnisse könnten Forschern auch helfen, alternative Therapien für die Störung zu entwickeln“, sagt Goenjian. Eine Gentherapie oder neue Medikamente könnten beispielsweise gezielter als bisher die Botenstoffe regulieren, die für die PTSD-Symptome verantwortlich seien.
Würde man einen Gentest auf diese erblichen Risikofaktoren entwickeln, könnte man Betroffene zudem besser vor traumatischen Erfahrungen bewahren: „Damit könnte man beispielsweise Soldaten identifizieren, die ein höheres Risiko für eine PTSD haben und ihnen dann entsprechend andere Einsatzgebiete zuteilen“, sagt Goenjian. Vor allem in den USA leiden viele Veteranen der Golfkriege und des Afghanistan-Einsatzes an Posttraumatischen Belastungsstörungen. (Journal of Affective Disorders, 2012)
(Journal of Affective Disorders / dapd, 03.04.2012 – NPO)