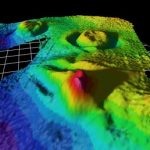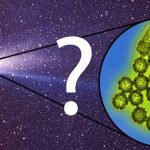Zellteilung ohne Zelle: Die Vorläufer der ersten lebenden Zellen könnten in den Poren von heißem Gestein entstanden sein, wie nun ein Experiment nahelegt. Denn in diesen winzigen Hohlräumen können sich an der Grenzschicht von Gas und Flüssigkeit Mikrotropfen bilden, die Biomoleküle anreichern und eine zellähnliche Umgebung schaffen. Ähnlich wie Zellen können sich diese Mikrotropfen zudem teilen, verschmelzen und heranwachsen, wie die Forscher im Fachmagazin „Nature Chemistry“ berichten.
Wo und wie entstand das erste Leben? War es in Tümpeln an Land oder am den heißen Quellen der Tiefsee? Sammelten sich die Lebensbausteine möglicherweise sogar in den Poren von Wassereis oder heißem Gestein? Bisher ist diese Frage offen. Es ist aber wahrscheinlich, dass die ersten biochemischen Reaktionen nicht in der freien „Ursuppe“, sondern in räumlich eingegrenzten Kompartimenten stattgefunden haben müssen. Denn nur so konnten sich die Grundbausteine des Lebens und ihre Vorstufen in ausreichender Konzentration anreichern, ohne sofort wieder verdünnt oder zersetzt zu werden.
Mikrotropfen als Zellvorläufer?
Eine denkbare Form solcher Zellvorläufer könnten winzige Öltröpfchen oder Bläschen gewesen sein, wie sie beim Aufeinandertreffen von Gas und Wasser oder Öl und Wasser entstehen. „Diese Phasentrennung führt unter ein breiten Palette von physiko-chemischen Bedingungen zur Bildung membranloser Mikrotröpfchen“, erklären Alan Ianeselli von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und seine Kollegen.
Die Frage blieb allerdings, ob und wie sich solche Mikrotröpfchen auch weiterentwickeln können – beispielsweise indem sie sich teilen, miteinander verschmelzen oder chemisch unterschiedliche Tochter-Bläschen bilden. Um das herauszufinden, haben Ianeselli und sein Team die Umgebung solcher präbiotischen Lebensvorläufer im Experiment rekonstruiert. Dafür nutzten sie eine Mikrofluidkammer, in der eine Polymermatrix die Struktur von Gesteinsporen nachbildete.