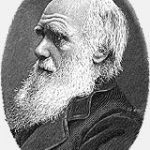Die Entschlüsselung zeigt: Wie erwartet, gleichen sich die Genome von Giraffe und Okapi in großen Teilen. Den Forschern zufolge ergaben ihre Analysen, dass die beiden Arten erst vor rund elf bis zwölf Millionen Jahren aus einem gemeinsamen Vorfahren hervorgegangen sind – rund fünf Millionen Jahre später als bisher angenommen. Zudem weisen die genetischen Profile beider Arten eine vergleichbar große Übereinstimmung mit dem Genom der Kuh auf – der Verwandtschaftsgrad von Okapi und Giraffe zum Rind ist somit ähnlich.
Wenige Gene machen den Unterschied
„Trotz dieser engen Verwandtschaft sieht das Okapi eher wie ein Zebra aus und verfügt nicht über die imposante Größe oder das starke Herz-Kreislauf-System der Giraffe“, sagen die Wissenschaftler. Doch nur eine kleine Zahl von Genen ist für diese augenscheinlichen Unterschiede verantwortlich.
Bei den Genvergleichen identifizierten Morris und seine Kollegen insgesamt 70 Gene, die bei der Giraffe zahlreiche Zeichen von Anpassungen aufweisen. Über die Hälfte dieser Gene codiert für Proteine, die die Entwicklung des Skeletts, des kardiovaskulären Systems oder des Nervensystems regulieren. Etliche der proteincodierenden Gene spielen dabei sowohl eine Rolle für das Herz-Kreislauf-System als auch für das Skelett.
„Die ungewöhnliche Körperform ist deshalb wahrscheinlich parallel mit der Entwicklung eines angepassten kardiovaskulären Systems entstanden, das es mit dieser einzigartigen Anatomie des Tieres aufnehmen konnte“, schreiben die Forscher.
Anpassungen für den Wachstumsschub
Für die langen Beine und den langen Hals der Giraffe, der trotz seiner Länge nicht mehr Wirbel hat als bei anderen Säugetieren, sind mindestens zwei Gene von besonderer Bedeutung: „Eines spezifiziert die Skelettregion, die stärker wachsen soll, das andere stimuliert das vermehrte Wachstum“, erklärt Agabas Team. „Das faszinierendste dieser Gene ist der Wachstumsfaktor FGFRL1.“
Dieser setzt den Forschern zufolge schon im Embryonalstadium wichtige Entwicklungsprozesse in Gang und spielt auch für das Knochenwachstum nach der Geburt eine tragende Rolle. Bestimmte Mutationen im FGFRL1-Gen werden sowohl bei Mäusen als auch beim Menschen teils mit schweren Schäden des Skelettes und kardiovaskulären Defekten in Verbindung gebracht. Bei der Giraffe sorgen Veränderungen dieses Gens jedoch für ihre rekordverdächtige Größe, die sie deutlich von ihrem engsten Verwandten unterscheidet.
Aufmerksamkeit für einen Giganten in Bedrängnis
Auch in Sachen Ernährung hebt sich die Giraffe vom Okapi ab: In freier Wildbahn frisst sie hauptsächlich Akazienblätter. Diese sind sehr nahrhaft, für die meisten Tiere jedoch giftig. Doch der Stoffwechsel der Giraffe hat sich im Laufe der Evolution an diese ungewöhnliche Nahrung angepasst und kommt mit der Toxizität der Pflanze bestens klar: „Davon zeugt eine ganze Reihe von Genen im Genom der Giraffe, die den Metabolismus regulieren und sich von denen des Okapis unterscheiden“, so die Forscher.
In Zukunft wollen sie die einzelnen Funktionen der bei der Entschlüsselung identifizierten Gene genauer unter die Lupe nehmen. „Wir hoffen aber auch, dass die Veröffentlichung des Genoms der Giraffe auf das faszinierende Tier und seine schwierige Situation aufmerksam macht. Denn die Giraffenpopulationen sind in den vergangenen fünfzehn Jahren um 40 Prozent zurückgegangen“, betont das Team. „Wenn das so weitergeht, wird es bis zum Ende dieses Jahrhunderts weniger als 10.000 Tiere in freier Wildbahn geben.“ (Nature Communications, 2016; doi: 10.1038/ncomms11519)
(Penn State University, 18.05.2016 – DAL)
18. Mai 2016