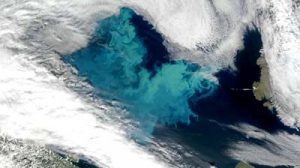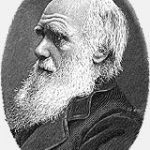Es waren zwar keine Dinosaurier sondern Wasserflöhe, aber das Prinzip war ähnlich: Wissenschaftler haben eine im Bodensee ausgestorbene Wasserflohart aus 40 Jahre alten Dauereiern wieder zum Leben erweckt. Das erlaubte die Artbestimmung und zeigte, dass eine Überdüngung des Sees diese Art irreversibel verdrängt hatte
Vom Menschen verursachte Umweltveränderungen haben Einfluss auf die natürliche Artenvielfalt. So hat die Überdüngung des Greifen- und Bodensees in den 1970/80er-Jahren dazu geführt, dass die Artenzusammensetzung der Seen veränderte. Wie, das haben Forschende der Eawag gemeinsam mit den deutschen Universitäten Frankfurt und Konstanz durch Erbgutanalysen von bis zu 100 Jahre alten Eiern des Wasserflohs nachgewiesen.
Die Evolutionsbiologin Nora Brede ist begeistert. „Wir konnten über 40 Jahre alte Dauereier aus dem Sediment des Greifensees im Labor wieder zu Leben erwecken.“ Das Experiment à la „Jurassic Park“ ist mehr als bloße Spielerei: So können die Wissenschaftler rückwirkend prüfen, welche Wasserflohart 1960 im See dominiert hat oder ob die in den 1970- und 1980er Jahren vorherrschende Art gegenüber Schadstoffen toleranter wurde.
Wasserfloheier als Genarchiv
Wasserflöhe (Daphnien) gehören zu den Krebsen. Sie können – zum Beispiel bei Nahrungsmangel – Dauereier produzieren, aus denen erst in besseren Zeiten wieder ein lebendiger Organismus heranwächst. Da die Eier in den datierbaren Sedimentschichten sauerstofffrei „eingelagert“ sind, kann ihre Erbsubstanz auch nach über 100 Jahren noch bestimmt werden.