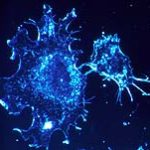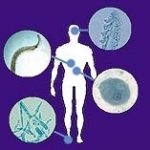Viren sind raffinierte Parasiten: Weil sie sich nicht selbst vermehren können, nutzen sie ihre Wirtszellen als Fabriken für den viralen Nachwuchs. Dazu schleusen sie eigene RNA in die Zellen ein. Dennoch sind die Wirtszellen den Parasiten nicht hilflos ausgeliefert. Ein bestimmtes zelluläres Protein erkennt die fremde RNA und löst Alarm aus. Welche biochemischen Mechanismen der Erkennung viraler RNA zugrunde liegen, berichtet jetzt ein Forscherteam als Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Molecular Cell“.
{1l}
Jede Zelle benötigt zum Leben ein ganzes Arsenal von Proteinen. Deren Bauanleitung ist in den Genen gespeichert, das sind Abschnitte des Erbmoleküls DNA im Zellkern. Soll ein bestimmtes Protein produziert werden, erfolgt in einem ersten Schritt die Abschrift des zugehörigen Gen in ein dazu passendes RNA-Molekül. Über Poren in der Membran des Zellkerns gelangt dieses in das Zellplasma, wo die Proteinfabriken der Zelle, so genannte Ribosomen, getreu der Bauanleitung die dazu passenden Proteine herstellen.
Protein erkennt Freibeuter-RNA
„Diese Fließbandproduktion können Viren aber auch für ihre eigenen Zwecke nutzen“, erklärt Professor Karl-Peter Hopfner vom Genzentrum der Ludwig- Maximilians-Universität (LMU) München und Leiter des internationalen Forscherteams. „Die Parasiten bestehen in der Regel nur aus einem RNA-Molekül als Erbgut, das von einer kleinen Proteinkapsel umhüllt ist. Die RNA enthält in erster Linie die Bauanleitungen für neue Kapselproteine. Gelangt sie in eine Wirtszelle, wird diese umprogrammiert, so dass die Zellmaschinerie hauptsächlich neue Viruskapseln produziert. Diese werden mit viraler RNA gefüllt – und eine neue Virengeneration befällt weitere Zellen.“
Menschliche Wirtszellen sind den viralen Freibeutern aber nicht wehrlos ausgeliefert: Ein bestimmtes Protein, RIG-I, erkennt die fremde RNA und löst Alarm aus. Dann wird der Botenstoff Beta- Interferon produziert, der bestimmte Killerzellen aktiviert – die Vorhut der Körperabwehr. „Außerdem wird durch diese Reaktion das zelluläre Selbstmord-Programm eingeleitet“, berichtet Hopfner. „Ohne Wirtszelle aber können sich die Viren nicht mehr vermehren.“ RIG-I unterscheidet virale RNA von zelleigener RNA anhand eines bestimmten chemischen Signals, ein so genanntes Triphosphat, das sich am Anfang des fadenförmigen RNA-Moleküls befindet. Auch die RNA im Zellkern trägt das Triphosphat-Ende. Auf dieses wird dann aber – anders als beim viralen Gegenstück – eine molekulare Kappe, das „Cap“, gesetzt.
Tandem löst Aktion aus
Dem Forscherteam gelangen nun erste Einblicke in die molekularen Mechanismen, die der Erkennung des RNA-Triphosphats zugrunde liegen. Dabei zeigte sich, dass ein bestimmter Bereich des RIG-I-Proteins für diesen Vorgang entscheidend ist. Nachdem sie Triphosphate erkannt hat, legt diese regulatorische Domäne einen molekularen Schalter um: Sie verbindet zwei RIG-I-Proteine in ein Tandem.
„Wir glauben, dass dieser molekulare Schalter eine wesentliche Rolle spielt in der Signalkette hin zur Produktion von Beta-Interferon“, so Hopfner. Zudem ist RIG-I eine ATPase, kann also die Energie aus der Spaltung des ATP-Moleküls nutzen. In diesem Fall wohl zur Erkennung der viralen RNAs sowie zur Einleitung der Immunantwort durch das Beta-Interferon. „Noch ist aber unklar, warum genau die Spaltung des ATPs nötig ist“, betont Hopfner.
„Denkbar ist, dass weitere Elemente viraler RNA wichtig sind, etwa um den Erkennungsprozess noch genauer und sicherer zu machen.“
Ähnlichkeit zu anderen Signalwegen
Mit Hilfe der Röntgenstrukturanalyse konnte zudem die dreidimensionale Struktur dieses Bereichs aufgeklärt werden. „Dabei gab es ein überraschendes Ergebnis“, so Sheng Cui, einer der beiden Erstautoren der Studie. „Die Domäne ist Elementen in anderen Signalübertragungswegen der Zelle, den so genannten kleinen G-Proteinen, sehr ähnlich.“ Der Grund dafür ist noch nicht bekannt.
Meist allerdings weist strukturelle Ähnlichkeit auf eine funktionale Gemeinsamkeit hin: Ähnliche Proteinbereiche erfüllen oft also ähnliche Aufgaben. Ob dies auch hier der Fall ist, soll die Fortführung des Projekts erweisen.
„Es wäre denkbar, dass die Aktivierungsmechanismen von ganz unterschiedlichen Wegen der Signalübertragung in der Zelle auf atomarer Ebene mehr Gemeinsamkeiten haben als bisher angenommen“, meint Hopfner. „Unsere Ergebnisse sind aber auf jeden Fall ein erster Schritt mit spannenden Ergebnissen – die eine ganze Reihe neuer Fragen aufwerfen.“
(Universität München, 05.02.2008 – NPO)