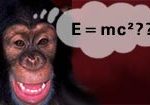Flügelschlagende Trinker: Nektarschlürfende Kolibris tolerieren ihre Nahrung auch mit Schuss – sie nehmen oft Alkohol auf, der durch natürliche Gärung des zuckerhaltigen Blütennektars entsteht, wie eine Studie jetzt zeigt. Dies macht sie aber trotzdem nicht dauerbetrunken. Denn die Kolibris achten sehr genau auf die Dosierung der unfreiwilligen Alkoholbeimischung, zudem baut ihr Körper das Ethanol sehr schnell wieder ab, wie die Forschenden erklären.
Früchte und Blütennektar sind bei einigen Tiere aufgrund ihres hohen Zuckergehalts und der großen damit verbundenen Kalorienmenge äußerst beliebt. Doch Teile dieser Süße können sich auf natürliche Weise in Alkohol verwandeln. Siedeln sich Hefen und Bakterien im Nektar an, fermentieren diese Teile des Zuckers und stellen dabei Ethanol her. So bringt es zum Beispiel der Nektar einer südostasiatischen Palmenart auf bis zu 3,8 Prozent Alkoholgehalt. Doch wie gehen Tiere wie der Kolibri damit um, wenn sie täglich 80 Prozent ihres Eigengewichts in Nektar zu sich nehmen?
Zuckerwasser mit Schuss
Julia Choi und ihre Kollegen von der University of California in Berkeley haben nun untersucht, welchen Alkoholgehalt Kolibris im Nektar präferieren, wenn sie die Wahl haben. Dafür boten sie männlichen Annakolibris jeweils die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Behältern mit Zuckerwasser zu trinken. Diese enthielten entweder gar keinen Alkohol oder ein beziehungsweise zwei Prozent.
Über mehrere Tage hinweg mischten Choi und ihr Team den Versuchsaufbau systematisch durch, sodass jede der drei Zuckerlösungen mindestens einmal gepaart mit jeder anderen angeboten wurde. Die Forschenden maßen nach jeder dreistündigen Auswahlrunde, wie viel Milliliter Zuckerwasser die Kolibris pro Behälter getrunken hatten. Dadurch konnten sie dann auf die Präferenzen der Vögel schließen.