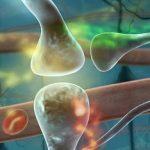Erstes Indiz: die Hirnstruktur
„Wir wissen heute, dass zwei entscheidende Veränderungen in der Hirnstruktur der Kinder zu dieser Schwäche führen“, erklärt Jens Brauer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. „Zum einen ist bei ihnen vor allem in einer bestimmten Region in der linken Hirnhälfte die Großhirnrinde etwas dünner.“ Zum anderen sind die Faserverbindungen zwischen den entscheidenden Spracharealen weniger ausgeprägt.

Anhand eines EEGs lassen sich Auffälligkeitn im Gehirn von legathenischen Kindern früh erkennen. © MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften
Diese Veränderungen in der Großhirnrinde lassen sich unter anderem mittels Elektroenzephalografie (EEG) erkennen. Dabei werden die Hirnströme des Kindes abgeleitet, während es einer Reihe von gleichen Silben oder Tönen lauscht, die nur hin und wieder durch einen abweichenden Laut unterbrochen werden. Fällt es Kindern schwer, diese Unregelmäßigkeiten zu erkennen, und bleiben dabei typische Ausschläge im EEG aus, ist das ein wichtiges Indiz für eine drohende Lese-Rechtschreibstörung.
„Mithilfe dieser Untersuchungen können wir anhand der neuronalen Reaktion bereits im Kindergartenalter erkennen, wenn Informationen zur Sprache anders als normal verarbeitet werden und so die Betroffenen identifizieren“, berichtet Brauer. Dennoch ist die reine Prognose anhand des EEG nicht aussagekräftig genug.
Zweites Indiz: 25 DNA-Varianten
Zusätzlich ziehen die Forscher daher die Gene für einen Test heran. Die Lese-Rechtschreibstörung ist zu 50 bis 70 Prozent genetisch bedingt. Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie haben eine umfassende Liste von DNA-Variationen identifiziert, die bei deutschen Legasthenikern an der Störung beteiligt sind. Aus diesen wählten die Forscher 25 Gen-Veränderungen aus, die sich gut überprüfen lassen.
Je mehr dieser Genvarianten bei einem Kind gefunden werden, desto höher ist bei ihm die Gefahr, von einer Lese-Rechtschreibstörung betroffen zu sein. „Für einige davon konnten wir nachweisen, dass sie in direktem Zusammenhang mit den Ergebnissen aus den Silben-Aufgaben der EEG-Untersuchungen stehen“, erklärt Arndt Wilcke vom Fraunhofer Institut. „Trägt ein Kind diese Varianten in sich, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihm die Aufgabe nicht gelingt.“
Kombinationstest bald marktreif
Am aussagekräftigsten ist es, wenn ein Kind bei beiden Tests Anzeichen für eine Legasthenie zeigt. „Indem wir die Indizien aus Gehirn und Genetik kombinieren, hoffen wir zukünftig auf eine noch höhere Trefferquote“, so Wilcke. „Wir sind jedoch zuversichtlich, hier in den nächsten Jahren die entscheidenden Fortschritte zu machen, so dass ein einfaches, präzises Diagnoseverfahren per EEG und Speichelprobe in greifbare Nähe rückt.“
Schon in den nächsten Jahren wollen die Forscher ein solches Verfahren zur Marktreife bringen. Dieser Test könnte dann beispielsweise routinemäßig bei Vorsorgeuntersuchungen von Kindern eingesetzt werden. „Wenn wir es schaffen, im Zuge von Vorsorgeuntersuchungen einen Großteil der betroffenen Kinder noch vor Schulbeginn zu erfassen, können gezielte Förderungsmöglichkeiten in dieser sensiblen Phase der Hirnentwicklung viele Defizite kompensieren“, erklärt Projektleiterin Angela Friederici vom Max-Planck-Institut.
„Wir ersparen den Kindern damit nicht nur Leid in der Schule. Wir eröffnen ihnen damit auch die gleiche Chance auf eine erfolgreiche Ausbildung, auf Teilnahme in der Gesellschaft und ein zufriedenes Leben“, so die Forscherin.
(Max-Planck-Gesellschaft, 28.07.2017 – NPO)
28. Juli 2017