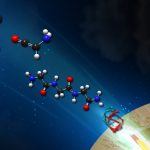Wässrige Kinderstube: Das erste Leben könnte in großen Natronseen entstanden sein – besonders mineralreichen alkalischen Gewässern. Denn anders als an vielen anderen Orten der Urerde könnte es in diesen Seen genügend Phosphor für Biomoleküle und die ersten Zellen gegeben haben, wie Forschende ermittelt haben.
Vor 3,5 bis vier Milliarden Jahren entstand das erste Leben auf der Erde. Aber wie und wo? Als Voraussetzung gilt eine Umgebung, in der genügend chemische Bausteine für Biomoleküle und Zellen vorhanden waren. Zu den möglichen Kandidaten für solche Wiegen des Lebens gehören daher hydrothermale Schlote im Meer, Einschlagskrater, Geysire und Gesteinsporen. In ihnen könnten sich die nötigen Minerale und Moleküle in ausreichender Konzentration angereichert haben.

Ohne Phosphor kein Leben
Nun ist ein neuer Kandidat hinzugekommen: große Natronseen. Wie Forschende um Craig Walton von der University of Cambridge argumentieren, könnte sich in diesen alkalischen, mineralreichen Seen eine essenzielle Lebenszutat angesammelt haben, die an anderen Orten wahrscheinlich eher Mangelware war. Die Rede ist von Phosphor – einem zentralen Bestandteil von organischen Molekülen wie DNA, RNA oder dem Energieträger ATP (Adenosintriphosphat).
Anders als andere wichtige Lebensbausteine wie Stickstoff oder Kohlenstoff ist Phosphor auf der Erdoberfläche relativ selten – damals wie heute. Doch wie Laborexperimente ergeben haben, erfordert präbiotische Chemie sehr hohe Phosphorkonzentrationen – etwa 10.000-mal mehr als in Wasser natürlicherweise vorkommt. Die Schlussfolgerung liegt daher nah, dass das erste Leben an einem Ort mit hoher Phosphorkonzentration entstanden sein muss – zum Beispiel in einem Natronsee.