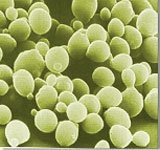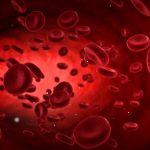Diabetes ist keine reine Krankheit der Idustrieländer mehr, sie nimmt auch in den Schwellenländern zu – wo oft das Geld für eine adäquate Behandlung fehlt. Jetzt haben Forscher in einer deutsch- indischen Kooperation eine neue Methode entwickelt, mit der günstiger als bisher Insulin zur Behandlung von Diabetes hergestellt werden kann. Schlüssel dafür ist eine spezielle Hefesorte.
Weltweit sind 285 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. Dabei ist die Zuckerkrankheit schon lange keine auf die Wohlstandsgesellschaft beschränkte Erkrankung mehr: Gerade Länder mit einer aufstrebenden Wirtschaft wie in Asien zeigen die höchsten Zuwachsraten. So ist Indien mit 50 Millionen Betroffenen das Land mit den meisten Diabetikern Für viele Menschen in ärmeren Ländern sind die Medikamente jedoch oft zu teuer. Die Beschaffung von Insulin scheitert in diesen Ländern an den Kosten. Ein weiteres Problem sind Patentrechte, die es für Jahrzehnte unmöglich machen, Medikamente nachzubauen und günstig zu vertreiben. Erst mit Ablauf eines Patents, wie jetzt bei der Herstellung von Insulin, können diese so genannten Generika billig hergestellt werden. Hier fehlt aber oft das „Insiderwissen“, um diese Medikamente auch in ärmeren Ländern herstellen zu können.
Bakterium oder Hefe als Bausteinlieferanten
Insulin war Anfang der 1980er Jahre das erste rekombinant hergestellte Medikament, das die amerikanische Zulassungsbehörde für Medikamente „FDA“ zur Anwendung beim Menschen zuließ. Heute erfolgt die Produktion von Insulin hauptsächlich über zwei Wege: Ein Vorläufer des Insulins wird in dem Bakterium Escherichia coli hergestellt und muss anschließend in aufwändiger Weise chemisch modifiziert werden. Der zweite Weg läuft über die bekannte Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae. Der Vorteil der letzteren Methode liegt darin, dass die Hefe das Vorläuferprotein direkt ins Medium abgibt und es somit nicht in einem weiteren Arbeitsschritt aus den Zellen isoliert werden muss.
Neue Hefesorte erhöht Ausbeute
Den gleichen Weg geht nun eine von Ursula Rinas und ihren Kollegen vom Helmholtz- Zentrum für