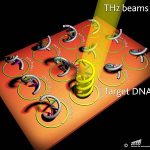„Eine Ausnahme bilden die Retroviren wie z.B. HIV“, erklärt Lars Hangartner vom Institut für Medizinische Virologie der Universität Zürich. „Retroviren packen ihre Erbinformation als RNA in die Virenpartikel ein, überschreiben diese RNA aber gleich nach der Infektion in DNA und setzen diese dann, sozusagen als Blaupause, ins Erbgut der Wirtszelle ein.“
Die genetische Information von Retroviren bleibt dadurch für immer mit der Wirtszelle verbunden und sie kann daher auch nach langer Zeit immer wieder von neuem reaktiviert werden. Entstehen über die Zeit Mutationen, können diese integrierten Retroviren zwar ihre Funktion – die Replikationsfähigkeit – verlieren, sie bleiben aber als genetische Retrovirusleiche (defekte Viren) im Wirtszell-Erbgut. Solche nicht oder nur noch teilweise funktionierenden Retrovirus-Fragmente machen über acht Prozent des Erbgutes der Menschen und Säugetiere aus, ihre Bedeutung für den Wirtsorganismus ist jedoch weitgehend unklar.
Aufgeschnappte Gene
Hangartner hat nun zusammen mit seinen Kollegen Markus Geuking und Professor Rolf Zinkernagel in einer neuen Studie gezeigt, dass die Trennung zwischen RNA-Viren und Retroviren nicht ganz so exakt erfolgt, wie bisher angenommen.
Aufbauend auf Ergebnissen aus der Mitte der 90er-Jahre konnten die Forscher nun belegen, dass Gene eines reinen RNA-Virus der Maus in das Erbgut der Wirtszelle integriert werden können – wenn sie von einem bestimmten Typus eines in der Wirtszelle integrierten, rudimentären, aber teilweise funktionierenden Retrovirusfragments aufgeschnappt werden.
Die Integration des RNA-Virus erfolgt zufällig und nicht durch einen spezifischen Mechanismus. Diese Art von Gentransfer wurde bisher als unmöglich angesehen, weshalb RNA-Viren als sichere Vehikel für das temporäre Einbringen von genetischer Information galten.
RNA-Viren gründlich untersuchen
Mechanismen dieser Art könnten in Menschen bei gewissen Anwendungen der somatischen Gentherapie oder bei gentechnisch veränderten Impfstämmen, die sich zurzeit in Entwicklung befinden, wirksam werden und daher für die Abschätzung der Sicherheit dieser Verfahren von Bedeutung sein.
Wie die Wissenschaftler in „Science“ schreiben, belegen die neuen Ergebnisse, dass RNA-Viren, die zur Anwendung im Menschen gedacht sind, diesbezüglich untersucht werden sollten – auch wenn sich dieses Zusammenspiel zwischen RNA-Virus und Retrovirusfragmenten höchstwahrscheinlich sehr selten und nur mit bestimmten RNA-Virus/Retrovirus-Kombinationen ereignen kann. Die Methoden für solche Untersuchungen sind vorhanden und äußerst sensitiv.
(idw – Universität Zürich, 16.01.2009 – DLO)
16. Januar 2009