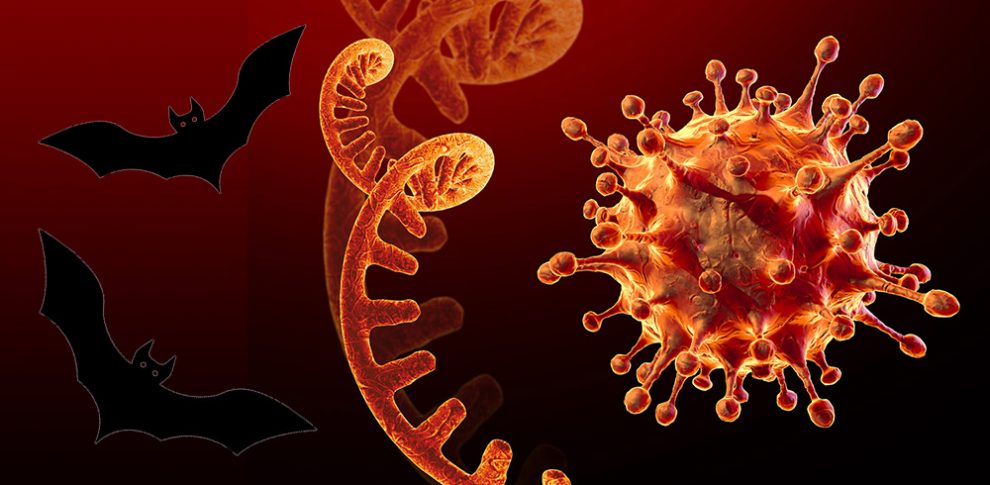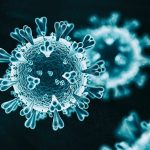Bei drei Spezies der Hufeisennasen – Rhinolophus malayanus, Rhinolophus marshalli und Rhinolophus pusillus – wurden die Wissenschaftler fündig: Sie wiesen in diesen Tieren Coronaviren nach, deren RNA zu mehr als 95 Prozent mit SARS-CoV-2 übereinstimmt. Einer dieser Virenstämme ist sogar zu 96,8 Prozent mit SARS-CoV-2 identisch, wie das Team berichtet – und damit ähnlicher als RaTG13 mit 96,1 Prozent. Die BANAL-52, BANAL-103 und BANAL-236 getauften Virenstämme müssen damit zum engsten Verwandtschaftskreis des Pandemie-Erregers gehören.
Bindungsstelle nahezu identisch – und infektiös
Noch bedeutender jedoch: Die drei Coronaviren sind SARS-CoV-2 nicht nur insgesamt sehr ähnlich – die Rezeptor-Bindungsstelle an ihrem Spike-Protein ist sogar nahezu identisch. „BANAL-52 und -103 teilen 16 der 17 Aminosäure-Enden, die mit dem menschlichen ACE2-Rezeptor interagieren“, schreiben Eloit und seine Kollegen. BANAL-236 besitzt immerhin 15 der 17 Kontaktstellen. Zum Vergleich RatG13 stimmt nur in elf dieser 17 Aminosäure-Enden mit SARS-CoV-2 überein.
Das weckte die Frage, ob die neu entdeckten Coronaviren-Varianten neben Fledermäusen auch Menschen befallen können. In biomolekularen Tests prüften die Forschenden dafür zunächst, ob die viralen Bindungsstellen an isolierte ACE2-Rezeptoren andocken können. Das Ergebnis: Sowohl die Variante BANAL-52/-103 als auch BANAL-236 bildeten Komplexe mit den Rezeptoren. Die Affinität für den menschlichen Zellrezeptor lag dabei ähnlich hoch wie beim Ursprungsstamm von SARS-CoV-2.
Dies bestätigte sich in Zellkultur-Tests: BANAL-236 konnte genauso effizient in menschliche Zellen eindringen wie die zu Beginn der Pandemie in Wuhan isolierte Ursprungsvariante von SARS-CoV-2, wie das Team berichtet. Die Ähnlichkeit der Viren ist so groß, dass Antikörper aus dem Blutserum genesener Covid-19-Patienten in den Tests auch BANAL-236 neutralisierten.
Hinweis auf natürlichen Ursprung von SARS-CoV-2
Nach Ansicht von Eloit und seinen Kollegen belegen diese Funde, dass SARS-CoV-2 keineswegs aus den „Nichts“ gekommen ist – und machen auch einen Ursprung im Labor deutlich unwahrscheinlicher. „Unsere Resultate zeigen, dass dem Pandemie-Erreger SARS-CoV-2 sehr ähnliche Sequenzen in der Natur existieren und in mehreren Spezies der Hufeisennasen nachgewiesen werden können“, schreiben sie.
Frühere Studien hatten bereits Hinweise darauf geliefert, dass Coronaviren Teile ihres Erbguts untereinander austauschen können und dies auch häufig tun. Wie die Forschenden feststellten, weisen auch die RNA-Sequenzen der neu entdeckten Virenvarianten Hinweise auf solche Rekombinationen auf. Die BANAL-Varianten aus Laos könnten demnach die gesamte Bindungsstelle ihres Spike-Proteins vom gemeinsamen Vorfahren mit SARS-CoV-geerbt haben, so eine Vermutung.
Die Furin-Spalte, die bei SARS-CoV-2 die krankmachende Wirkung beeinflusst, fehlt den BANAL-Fledermausviren zwar noch. Denkbar ist aber, dass der Vorläufer von SARS-CoV-2 diese durch eine weitere Rekombination mit einem Coronavirus erhielt. „Unsere Ergebnisse stützen die Hypothese, dass SARS-CoV-2 durch die Rekombination von bereits in Rhinolophus-Fledermäusen existierenden Sequenzen entstanden ist“, erklären Eloit und sein Team.
Haben sich schon Menschen mit BANAL-Viren infiziert?
Die Entdeckung der drei neuen Fledermaus-Coronaviren hat aber auch Bedeutung für das Epidemie-Risiko in Südostasien: Weil alle drei in Nordlaos nachgewiesenen BANAL-Stämme menschliche Zellen infizieren können, besteht erhöhte Ansteckungsgefahr. „Menschen, die in den Höhlen arbeiten, wie beispielsweise Guano-Sammler, aber auch Touristen auf Höhlentour oder bestimmte religiöse Gemeinschaften, die Zeit in den Höhlen verbringen, haben ein besonders hohes Risiko, sich zu infizieren“, warnen die Wissenschaftler.
Als nächstes wollen Eloit und sein Team untersuchen, ob sich möglicherweise schon Teile der heimischen Bevölkerung mit einem der BANAL-Stämme angesteckt haben und ob diese Infektionen Symptome hervorgerufen haben. Zudem sind weitere Labortests und Versuche mit den isolierten BANAL-Varianten geplant. (Nature Portfolio Preprint, Research Square, 2021; doi: 10.21203/rs.3.rs-871965)
Quelle: Nature, Research Square
30. September 2021
- Nadja Podbregar