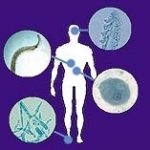Folgenreiche Begegnung: Die Wiege der untergärigen Biere könnte im berühmten Münchener Hofbräuhaus gestanden haben. Denn im Jahr 1602 kamen dort wahrscheinlich die beiden Hefestämme in Kontakt, aus denen die für Lagerbiere nötige Hefeart entstand. Eine entscheidende Rolle für diese Kreuzung spielte Herzog Maximilian I. von Bayern, der damals Braumeister aus der Oberpfalz und dem Harz mitsamt ihrer Hefen anheuerte – erst dies brachte die Hefen zusammen, wie Forscher berichten.
Bier wird schon seit Jahrtausenden gebraut. In den frühen „obergärigen“ Brauereien wandelte der wilde Hefepilz Saccharomyces cerevisiae den Zucker in der Maische aus Getreidemalz und anderen Zutaten in Alkohol um. Allerdings funktionierte dies nur bei Wärme, weil diese Bierhefe kälteempfindlich ist. Deshalb war das Bierbrauen bei uns in Mitteleuropa lange Zeit nur im Sommer möglich.
Folgenreiche Hefe-Kreuzung
Erst im Mittelalter änderte sich dies: In Süddeutschland kam es zu einer Kreuzung der gängigen Bierhefe mit einer zweiten, wilden Hefeart, Saccharomyces eubayanus. Daraus entstand eine neue Bierhefe, S. pastorianus, die die Maische auch bei kühlen Temperaturen fermentierte. Diese Hefe-Kreuzung begründete das untergärige Bierbrauen – und schuf die Vorausetzung für Biere wie Pils, Lagerbier und Schwarzbier. Solche untergärigen Biere machen heute rund 90 Prozent aller Biersorten aus.
Offen war jedoch bisher, wo und wie es zu der folgenreichen Kreuzung von S. cerevisiae und S. eubayanus kam. „Die gängige Ansicht ist, dass die damals in Brauereien verbreiteten Bierhefen zufällig durch die seltenere Hefe S. eubayanus verunreinigt wurde“, erklären Mathias Hutzler von der TU München und seine Kollegen. „Diese beiden kreuzten sich dann und bildeten die neue Spezies S. pastorianus.“