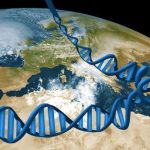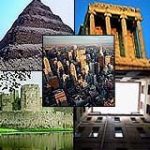Fisch oder Fleisch? Mit diesem Ernährungsproblem beschäftigen sich Wissenschaftler am Forschungszentrum Terramare. Sie untersuchen aber nicht den Speiseplan moderner Menschen, sondern sie wollen herausfinden, was norddeutsche Bronzezeitler vor drei- oder viertausend Jahren auf dem Teller hatten. Darüber Aufschluss geben soll die Fettsäurezusammensetzung von Speiseresten in bronzezeitlichen Scherben, die jetzt mit einem neuen methodischen Ansatz analysiert wird.
Archäochemie ist ein in Deutschland noch kaum beschrittenes Gebiet, wenn es darum geht, zu erkunden, wie unsere Vorfahren lebten. Sehr viel dünner noch wird die Datenlage, wenn man sich mit chemischen Methoden in die Bronzezeit und Römerzeit des Küstenraumes wagt. Diesem Manko wird man nun am Forschungszentrum Terramare abhelfen.
Ein kürzlich mit Unterstützung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) neu beschafftes Massenspektrometer macht es möglich. Es eröffnet aktuell die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung dem Speiseplan unserer Vorfahren auf den Grund zu gehen. Untersucht werden derzeit Grabungsreste aus der Nähe von Rodenkirchen und aus Bentumersiel bei Leer.
Massenspektrometer im Einsatz
„Ob Fleisch, Fisch oder überwiegend Milchprodukte verzehrt wurden, dafür können massenspektrometrische Untersuchungen an Tonscherben über Fettsäuremuster, die wir mit unserem Massenspektrometer ermitteln können, Auskunft geben“, so Ralf Wöstmann, Umweltwissenschaftler am Forschungszentrum Terramare. Verkohlte Speisereste auf Scherben werden mit unterschiedlichen Lösungsmitteln behandelt, um an die Fette zu gelangen. Zusatz von Lauge setzt Fettsäuren frei, die dann zunächst über einen so genannten Gaschromatographen geschickt werden. Abhängig von ihren chemischen wie physikalischen Eigenschaften halten sich die Fettsäuren in diesem Gerät unterschiedlich lange auf.