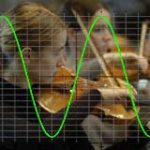Im zweiten Studienteil bekamen alle Teilnehmenden 16 kurze Musikclips aus verschiedensten Genres zu hören. Für jeden sollten sie angeben, ob sie ihn als eher angenehm oder unangenehm empfanden. Auf Basis dieser Daten untersuchten Greenberg und sein Team, ob es zwischen den fünf psychologischen Persönlichkeitstypen und dem Musikgeschmack einen Zusammenhang gibt.
In einem Online-Tool haben die Forschenden eine Kurzversion des zweiten Testteils ins Internet gestellt. Jeder kann dort selbst testen, wie gut Persönlichkeitsmerkmale und Musikvorlieben zusammenpassen.
Kultur- und Kontinent übergreifende Parallelen
Die Auswertung ergab: Obwohl Menschen aus aller Welt an der Studie teilnehmen, gab es auffallende, kulturübergreifende Übereinstimmungen. Demnach beeinflusst der Persönlichkeitstyp eines Menschen, welche Songs oder Musikstücke er bevorzugt – unabhängig davon, in welchem Land oder auf welchem Kontinent jemand lebt. „Wir waren überrascht, wie sehr diese Zusammenhänge zwischen Musik und Persönlichkeit sich überall auf dem Globus wiederfanden“, sagt Greenberg.
Nach Ansicht der Forschungsteams bestätigt dies, dass Musik tief in unserer Psychologie verankert ist – und dass sie im wahrsten Sinne des Wortes völkerverständigend wirken kann. „Menschen mögen durch Geografie, Sprache und Kultur voneinander getrennt sein. Aber Musik kann eine Brücke bilden, wenn ein Introvertierter in einem Teil der Welt die gleiche Musik mag wie Introvertierte anderswo“, erklärt Greenberg.
Welcher Persönlichkeitstyp mag was?
Den Daten zufolge bevorzugen extrovertierte Menschen eher Songs und Musik mit Upbeat-Tempo, wie Rap, Euro-Pop oder auch elektronische Musik. Wie die Forschende erklären, passt dies gut zum psychologischen Profil dieses Persönlichkeitstyps, der durch Geselligkeit, Optimismus, Aktivität und Abenteuerlust geprägt ist. Ein positiver, rhythmusbetonter Song wie „Shivers“ von Ed Shieran gefällt dabei Extrovertierten in Europa genauso wie in Indien oder Argentinien.
Menschen mit hohen Werten bei der Verträglichkeit bevorzugen hingegen oft sanfte, langsamere Popsongs, Softrock oder auch Blues. Wenig überraschend war auch die Beobachtung, dass gewissenhafte, ordnungsliebende Menschen meist wenig mit Hard Rock, Metal oder Punk anfangen konnten. Menschen mit hohen Werten bei der Offenheit sind hingegen auch in ihrem Musikgeschmack experimentierfreudiger und können sich daher auch für Jazz oder Avantgarde erwärmen.
Überraschung beim Neurotizismus
Überrascht wurden die Wissenschaftler jedoch von einem Persönlichkeitstyp: „Wir dachten, dass Menschen mit hohen Neurotizismus-Werten entweder traurige Musik bevorzugen oder aber Upbeat-Stücke, die ihre Stimmung verbessern können“, sagt Greenberg. „Stattdessen stellten wir fest, dass solche Menschen offenbar besonders intensive Musikstile präferieren – möglicherwiese weil diese ihre inneren Ängste und Frustrationen widerspiegeln.“
Als „intensive Musik“ werden dabei aggressive, laute und verzerrte Musikstücke eingestuft, wie sie beispielsweise für Punk, Heavy Metal oder Hard Rock typisch sind. „Das war überraschend, aber Menschen nutzen Musik eben auf unterschiedliche Weise – einige um ihre Stimmung zu ändern, andere eher für eine Katharsis“, so Greenberg. Die intensive Musik könnte unsicheren, gestressten und ängstlichen Menschen dabei helfen, ihre inneren Spannungen abzubauen.
Keine festgefügten „Schubladen“
Allerdings: Diese Zuordnungen und Ergebnisse bedeuten nicht, dass jeder Metal-Fan neurotisch oder jeder Freejazz-Liebhaber besonders offen sein muss, wie die Forschenden betonen. „Jeder von uns zeigt eine Kombination der verschiedenen Persönlichkeitsfaktoren, die auch unsere musikalischen Vorlieben in unterschiedlich starkem Maße prägen“, erklärt Greenberg. „Unsere Ergebnisse basieren hingegen auf Durchschnittswerten.“
Hinzu kommt, dass sich musikalische Vorlieben ebenso wie die Gewichtung der Persönlichkeitsfaktoren im Laufe der Zeit und des Lebens wandeln können. „Sie sind nicht in Stein gemeißelt“, betont Greenberg. Künftige Studien sollten daher die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Musik eingehender und tiefgreifender untersuchen. Das könnte dazu beitragen, eine nuanciertere Sicht auf die biologischen und kulturellen Faktoren zu gewinnen, die unsere musikalischen Präferenzen prägen. (Journal of Personality and Social Psychology, 2022; doi: 10.1037/pspp0000397)
Quelle: University of Cambridge
15. Februar 2022
- Nadja Podbregar