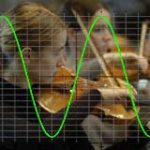Bei einem Streichquartett gibt es keinen Dirigenten, der den Takt angibt. Wie aber schaffen es die Musiker, trotz ihrer individuellen Spielweise synchron zu bleiben? Das haben britische Forscher jetzt untersucht – mit teilweise überraschenden Ergebnissen. Denn je nach Quartett erfolgt die unbewusste Synchronisation entweder hierarchisch oder aber ganz demokratisch – jeder folgt jedem.
Zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello – das ist die klassische Zusammensetzung eines Streichquartetts. Typischerweise hat dabei jedes Instrument seine eigene Stimme, im Zusammenspiel entsteht daraus der harmonische Wohlklang. Die Schwierigkeit dabei: Die klassische Musik lebt von der Interpretation. Ein winziges Verzögern hier, eine leichte Beschleunigung dort hauchen dem Stück Leben ein und machen das Spiel der Musiker unverwechselbar und individuell.
Freiheit trotz Takt
„Im Allgemeinen timen Musiker die Tonanfänge daher nie exakt so, wie es in der Partitur steht“, erklären Alan Wing von der University of Birmingham und seine Kollegen. Das aber macht das Zusammenspiel im Quartett besonders schwierig, denn es gibt keinen Dirigenten, der den Takt vorgibt. Stattdessen müssen sich die Spieler durch intensive Proben aufeinander einstimmen und erspüren, wo jeder einzelne welche Variation einbringt und wie sie sich am besten daran anpassen.
„Wir geben einander Freiheit – aber es ist ein natürliches Geben und Nehmen“, erklärt der Cellist des berühmten Guarneri-Quartetts, David Soyer. Wie aber funktioniert dies in der Praxis? Gibt es trotz scheinbar gleichberechtigtem Ensemblespiel einen „Leithammel“, der Ton und Tempo vorgibt? Oder passt sich jeder Musiker in gleichem Maße an seine Mitspieler an? Das haben Wing und seine Kollegen nun am Beispiel zweier international bekannter Streichquartette untersucht.