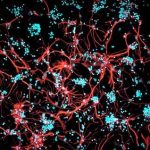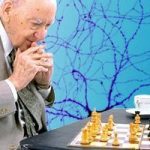Theorie des Bindungsstils
Die Theorie des Bindungsstils wurde in den 1960er Jahren entwickelt, aber bis heute ist dessen Beziehung zu Hirnaktivitäten unklar. „Zum ersten Mal hat unsere Arbeit Unterschiede in der Hirnaktivität aufdecken können, die möglicherweise in diesen individuellen Unterschieden begründet sind“, sagt Vuilleumier.
Vuilleumier und seine Mitarbeiter untersuchten die Auswirkungen des Bindungsstils bei Versuchspersonen, deren Gehirne sie scannten, während diese an einem Spiel teilnahmen. Die Teilnehmer hatten Kontakt zu virtuellen Partnern, die entweder zu ihrem eigenen oder zum gegnerischen Team gehörten. Der virtuelle Partner lächelte oder schaute zornig drein, je nachdem ob der Teilnehmer am Spiel Erfolg hatte oder verlor.
„Da der Bindungsstil sehr eng davon abhängt, wie Menschen Zugehörigkeit oder Gegnerschaft bei Begegnungen signalisieren, sagten wir voraus, dass der Bindungsstil den jeweiligen Gesichtsausdruck für eine Bewertung formt“, erklärt Vuilleumier.
Reaktionen hängen von der Persönlichkeit ab
Und genau das geschah. Wurden die virtuellen Partner als Verbündete wahrgenommen und lächelten zu dem Erfolg eines Teampartners, wurden die „Belohnungsareale“ im Gehirn aktiviert, etwa das ventrale Striatum und die ventralen tegmentalen Regionen. Diese Hirnreaktionen waren bei den Menschen, die eher andere meiden, schwächer ausgeprägt.
Schaute der verbündete Partner zornig, weil sein Teammitglied versagte, steigerten sich die Aktivitäten im Mandelkern (Amygdala), der Region im Gehirn, die mit Furcht und Angst verknüpft ist. „Die Reaktionen in der Amygdala hingen auch von der Persönlichkeit ab und waren sehr viel stärker bei Teilnehmern mit ängstlichem Bindungstil“, sagte Vuilleumier. Lächelte der virtuelle Gegner über Misserfolge von Teilnehmern oder schaute wütend, wenn sie Erfolg hatten, dann nehmen auch die Aktivitäten in den Regionen des Gehirns zu, die mit dem zu tun haben, was andere denken bzw. die mit Wachsamkeit verknüpft sind (Sulcus temporalis superior und Gyrus cinguli).
„Diese Ergebnisse zeigen erstmals, dass der gleiche Gesichtsausdruck verschiedene Reaktionsmuster in den für Gefühle zuständigen Hirnarealen auslösen kann, wenn der gesellschaftliche Kontext die soziale Bedeutung verändert“, sagt Vuilleumier. Die Arbeit erbringt auch den Nachweis, dass Bindungsstile ihren Ursprung, im Gehirn haben. „Diese neue Ergebnisse führen letztendlich vielleicht dazu, angemessene Behandlungsstrategien für klinisch relevante Erkrankungen zu entwickeln, wie Autismus und Phobien“, erklärt Vuilleumier.
Autismus auf der Spur
Für die Erforschung und Behandlung von Autismus könnte auch die Arbeit von Professorin Tania Singer wichtig sein. Ihr Team von der Universität Zürich untersuchte Patienten mit Autimus sowie mit Alexithymie, einer Erkrankung, die es den Betroffenen schwer macht, ihre Gefühle zu verstehen und zu beschreiben. Getestet wurde dabei, inwieweit diese Menschen fähig sind, sich anderen Menschen zuzuwenden.
Die Forscher verwendeten einen Fragebogen, um das Ausmaß von Alexithymie und Empathie herauszufinden. Dabei verglichen sie Menschen mit autistischen Erkrankungen (ASD, Autistic Spectrum Disorder) mit einer Kontrollgruppe ohne ASD. Es stellte sich dabei heraus, das Menschen mit höheren Alexithymie-Werten wenig Empathie zeigten, gleichgültig, ob sie ASD hatten oder nicht. Danach scannten die Forscher das Gehirn der Teilnehmer, während sie ihnen unangenehme Bilder zeigten, und baten sie, ihre Gefühle zu schildern.
Es zeigte sich, dass die Gehirnaktivitäten der Teilnehmer beider Gruppen mit hohen Alexithymie- und niedrigen Empathie-Werten, in der vorderen Inselregion des Gehirns geringer waren, jenem Areal, das mit Selbstreflexion verbunden ist. Diese Ergebnisse sind interessant, da sie zeigen, dass man erst seine eigenen Gefühle verstehen muss, um die Gefühle anderer zu verstehen. „Diese Fähigkeit ist mit der Funktion der Inselregion verbunden“, sagt Singer. „Die vordere Hirnregion der Insel scheint die Fähigkeit zu unterstützen, eigene Gefühle sowie die Gefühlssituation anderer zu verstehen.“
Ist Empathie trainierbar?
Die Forschungsergebnisse zeigen auch, dass ASD nicht den Ausschlag dafür gibt, ob ein Mensch weniger emphatisch ist, sondern dass das eher vom Grad der Alexithymie abhängt. „Nur Menschen mit Alexithymie haben einen Mangel an Empathie“, erklärt Singer. „Allerdings gehen ASD und Alexithymie häufig zusammen“. Sie will jetzt untersuchen, ob es möglich ist, das Gehirn so zu trainieren, dass es emphatischer wird.
„Wir arbeiten mit buddisthischen Mönchen, um zu sehen, welche Netzwerke mit diesen emphatischen Techniken verbunden sind“, sagte sie. „Wir hoffen, die Erforschung der Krankheit und das Training gesunder Erwachsener miteinander zu verbinden, um zu sehen, ob wir dieses Training auch zur Behandlung der Krankheit einsetzen können.“
(ProScience Communications, 15.07.2008 – DLO)
15. Juli 2008