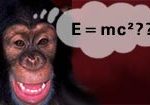Farbspiele auf der Haut
Für ihre Studie machten die Wissenschaftler mithilfe von Unterwasserrobotern Videoaufnahmen von insgesamt 30 Humboldt-Kalmaren im sogenannten Kalifornienstrom des nördlichen Pazifik. Wie sie berichten, hielten sich die Tintenfische in Tiefen von 266 bis 848 Metern auf und zeigten die typischen Farbsignale, wenn sie mit anderen Kopffüßern derselben Spezies unterwegs waren.
Burford und Robison analysierten das Filmmaterial, um wiederkehrende Muster in diesen Farbspielen zu entdecken: Gab es Unterschiede zwischen jagenden und nicht jagenden Humbold-Kalmaren? Und wie veränderte sich die Erscheinung ihrer Haut abhängig von der Zahl der insgesamt anwesenden Tintenfische?
Komplex wie bei einer Sprache
Die Auswertungen bestätigten, dass die Pigmentierungsmuster tatsächlich kontextabhängig waren. Je nach Situation nutzten die Kopffüßer demnach ganz spezielle Signale. Die farbigen Zeichen auf der Haut waren dabei so detailreich und komplex, dass die Tiere damit tatsächlich präzise Nachrichten vermitteln könnten.
Die Forscher wollen sogar für Sprache typische Elemente erkannt haben, die beispielsweise Attributen oder Positionsworten entsprechen könnten. „Unsere Daten legen nahe, dass die von Dosidicus gigas gezeigten visuellen Signale Merkmale mit fortgeschrittenen Formen der tierischen Kommunikation gemein haben“, konstatieren Burford und Robison.
Beleuchtung durch Photophore
Wie aber werden die kommunizierten Informationen in der Dunkelheit sichtbar? Die Forscher hatten einen Verdacht: Neben den für die Farbwechsel zuständigen Chromatophoren besitzen Humboldt-Kalmare unter der Haut auch sogenannte Photophore. Diese Leuchtorgane sind in der Lage, Licht zu erzeugen, und könnten die Farbmuster illuminieren – wie das Hintergrundlicht, welches die Buchstaben bei einem E-Book-Reader hervorhebt.
Doch stimmt das auch? Leider überdeckte das künstliche Licht, das für die Filmaufnahmen nötig war, das subtile Leuchten der Tiere. Daher wählten die Wissenschaftler einen anderen Ansatz. Sie untersuchten, wo am Tintenfischkörper die meisten Leuchtorgane sitzen.
Anpassung an das Leben im offenen Meer
Dabei stellten sie fest: Tatsächlich ist die Dichte der Photophore dort am höchsten, wo die Kalmare ihre komplexesten Farbmuster zeigen – zwischen den Augen und an den Rändern der Flossen. Für das Forscherteam ist damit klar, dass die Kalmare in der Dunkelheit über beleuchtete Farbmuster miteinander kommunizieren.
„Viele Kopffüßer, die in flachen Gewässern leben, besitzen diese Leuchtorgane nicht. Es könnte sich daher um eine entscheidende evolutionäre Innovation für das Leben im offenen Ozean handeln“, sagt Burford. Die Fähigkeit zur komplexen Kommunikation fördert wahrscheinlich das Gruppenverhalten dieser sozialen und intelligenten Tiere, wie er erklärt.
Weitere Forschung geplant
In Zukunft wollen die Wissenschaftler das Kommunikationsverhalten der Kalmare näher untersuchen. Dank verbesserter Technik könnten sie bei weiteren Untersuchungen das Leuchten der Tiere direkt im Wasser sichtbar machen und ihre Theorie so bestätigen. Zudem wollen sie herausfinden, ob die Tintenfische tatsächlich in einer der menschlichen ähnlichen Sprache miteinander kommunizieren.
„Die Signale von Kopffüßern im tiefen Ozean müssen weiter erforscht werden, um zu verstehen, wie und wieviel Information in einer der herausforderndsten Umgebungen des Planeten im Hinblick auf visuelle Kommunikation geteilt werden kann“, so das Fazit des Teams. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020; doi: 10.1073/pnas.1920875117)
Quelle: PNAS/ Stanford University
24. März 2020
- Daniela Albat