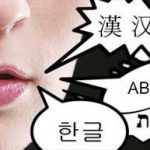„Alles“, „nichts“ oder „manche“: Schon Dreijährige benutzen erste abstrakte Mengenwörter. In welcher Reihenfolge sie sich solche Begriffe aneignen, ist dabei offensichtlich bei allen Kindern auf der Welt ähnlich. Das legt nun ein Experiment nahe. Demnach scheint das Lernen quantitativer Begrifflichkeiten einem universellen Schema zu folgen – und ist weitestgehend unabhängig von der Muttersprache.
Sprache ist das, was den Menschen ausmacht. Wörter lernen, sie nach bestimmten Regeln kombinieren und auf diese Weise die Welt beschreiben – das können nur wir. Das Vermögen zum Spracherwerb ist uns in die Wiege gelegt. Schon Säuglinge erkennen zum Beispiel, wenn jemand völlig falsche Silbenkombinationen äußert. Doch bis sie selber Wörter aussprechen und sinnvoll benutzen können, dauert es seine Zeit.
Ungefähr im Alter von drei Jahren verfügen Kinder über einen umfangreichen Fundus an Vokabeln und können einfache Sätze problemlos verstehen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie auch die ersten Zahlenwörter kennengelernt – und benutzen darüber hinaus abstrakte Begriffe für Mengen wie „alles“ oder „manche“. Doch nach welchem Prinzip eignen sie sich diese Wörter für quantitative Beschreibungen an?
Wahr oder falsch?
Sprachwissenschaftler um Napoleon Katsos von der University of Cambridge sind dieser Frage nun nachgegangen. Sie wollten testen, ob Kinder abstrakte Mengenwörter womöglich in einer festgelegten Reihenfolge lernen, die unabhängig von ihrer Muttersprache ist. Studien deuten darauf hin, dass diese Annahme zumindest für konkrete Zahlenwörter zutrifft. Demnach lernen Kinder Zahlen in der Regel in aufsteigender, numerischer Folge – ein Prinzip, das für Mengenwörter allerdings nicht anzuwenden ist. Diese lassen sich schließlich nicht so leicht ordnen.